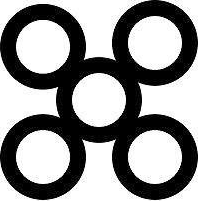24
Es war nach Mitternacht, als Marie die schöne geschnitzte und sorgfältig grün-weiß bemalte Haustür zu ihrem Wohnhaus ihres kleinen Hofes aus roten Backstein aufschloss. Bis auf die Flurbeleuchtung, die ihre Mutter ihr zur Begrüßung immer anließ, wenn sie erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kam, lag der ganze Hof im Schwarz der ländlichen Nacht. Bis auf sanfte Windböen, die die Blätter der Pappeln entlang der Einfahrt zu einem leichten Rauschen aneinanderklatschen ließen, war kein Laut zu hören.
Marie liebte die Ruhe ihres Zuhauses. Während ihrer Ausbildungs- und ersten Berufsjahre im Ruhrgebiet war es nie wirklich still um sie herum gewesen. Irgendetwas tutete immer oder eine Tür klapperte oder ein Düsenjäger schoss über einem entlang oder ein Radio krächzte oder säuselte von irgendwoher Musik in den Äther oder Menschen redeten oder eine Straße wurde per Presslufthammer aufgerissen oder ein Auto hupte oder Kinder schrieen im Spiel herum oder Türen schlugen zu oder eine Straßenbahn quietschte um die Kurve oder, oder …
In der Großstadt war es nie wirklich still. Wie durch eine akustische Luftverschmutzung war immer irgendetwas zu hören, drangen immer Geräuschpartikel in Maries empfindliche Ohren. In welcher Stille – die nicht nur, aber überwiegend schöne Seiten für Marie als Kind und Heranwachsende gehabt hatte – sie aufgewachsen war, wurde ihr erst bewusst, als es diese Stille nicht mehr gab. Denn wenn in diese wirkliche Stille ein Geräusch eindrang, wirkte es so zielgerichtet, so, als hielte die Welt für diese Äußerung der Natur ihre Arme auf. Ein Nacheinander der Ereignisse, dass einem eine Überschaubarkeit der Lebensabläufe vorgaukeln konnte.
Marie ließ sich jetzt bereitwillig diese Überschaubarkeit ihrer Lebensereignisse vorgaukeln und setzte sich, obwohl sie zugleich todmüde war – zu müde zum schlafen, wie sie gerne sagte – auf die kleine Holzbank neben ihrem Hauseingang. Das Flurlicht hatte sie ausgemacht, nachdem sie ihre Sachen abgestellt hatte. Und ein Glas Wasser hatte sie sich noch geholt, ein wenig Nachdurst auf das köstliche thailändische Essen. Den Koch hätte sie so vom Kochtopf weg klauen können. Kulinarische Köstlichkeiten, geschweige denn noch vegetarische, fehlten Marie hier oben wirklich sehr.
Schon allein deshalb musste sie tatsächlich häufig persönlich nach Hamburg fahren. Dieser Aspekt des Falls kam ihr gerade recht.
Marie legte den Kopf in den Nacken. Aus dem sie umhüllenden, bis in die Unendlichkeit reichenden Schwarz blinkten Mirriaden von Sternen über ihr im nachtschwarzen Himmel. Wie hieß es gleich: Alles hat einen Stern. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Baum und sogar jedes Kraut, jeder Grashalm. Einfach alles, was ist, hat eine Entsprechung dort oben, die über sein Werden und Sein, sein Wachsen und Vergehen wacht. Ich glaube, das steht im Koran, oder vielleicht im Sohar, dachte Marie mit einer in ihr leuchtenden Zufriedenheit. Sie liebte diese Momente der sie so vollständig umhüllenden Stille und lehnte sich mit einem leichten Räkeln entspannt zurück.
Wie die vereinzelten Geräusche der Nacht – ein zarter Windhauch, ein Käuzchenruf und ein Rascheln unbekannten, aber sicher tierischen Ursprungs im Gebüsch an der Hauswand – reihten sich nun auch ihre Gedanken ohne Hetze aneinander, auch durch die leeren Pausen durch den nun in ihr aufkommenden Halbschlaf noch leichter voneinander unterscheidbar.
Die ihr inzwischen fast vertrauten Trommelrhythmen begleiteten das kurz auftauchenden Bild des verstümmelten toten Babys. Ein weißes schwarzes Baby. Unfassbar, was die Natur alles hervorbrachte. Nach der Kassiopeia tauchte ein großes Containerschiff in Maries Kopf auf, darauf Imbakwe Murundi mit seinen beiden Kindern, einer schwarzhäutigen Tochter und dem hellweißen Baby. In ihrem Bild war Murundi schwarzhäutig, sogar sehr dunkel. Maries Blick folgte einer Sternschnuppe: Oh, wie sehr sie sich wünschte, mit Martin glücklich zu sein – und mit Lukas natürlich. Sie wünschte alles Gute und Liebe für ihre Familie – inklusive Martin. Und auch Klara. Dass sich das Verhältnis zu ihrer Mutter so gut entwickelt hatte, kam Marie immer noch wie ein Wunder vor. Dann bewegte sich das Portrait des bulligen Schwarzen in Soselos Haus. Der Fokus ging zurück, wie das Zurückziehen eines Zooms, so dass ein gedrungener Körper unter dem Kopf zum Vorschein kam. Er hielt eine große Gartenschere in den Händen. So eine, mit der man früher Hecken gestutzt hatte, ehe nun jeder Vorgartengärtner solch ein eletrisches Nervgerät besaß, dass nicht unerheblich zur akustischen Umweltverschmutzung beitrug. Der große Wagen setzte ein nächstes Pausenzeichen.
Dann rannte eine Frau, rannte und rannte. Wohl vor irgendetwas davon. Sie presste ein Bündel an ihre Brust. Es glitt ihr aus den Händen. Das Bündel fiel zu Boden, ins Wasser, es trieb davon. Es weinte – wie ein Baby weint.
Jetzt musste Marie aber nun endgültig ins Bett, wenn das schon wieder mit den Visionen losging. Sie wollte den Tag gut, harmonisch abschließen. Nun zum Schluss noch solch ein erschütterndes, aufwühlendes Bild.
Doch auch in der Nacht behielten die unangenehmeren Traumbilder und Visionen die Oberhand. Die davonlaufende Frau tauchte mehrmals auf, aber auch ein dunkelhäutiges Mädchen. Die Frau und das Mädchen schienen immer wieder ineinander überzugehen, sich ineinander zu verwandeln. Mutter gleich Schwester? Die überdimensionale Schere. Das Babyweinen. Ein großer schwarzer Wagen, der mit quietschen Reifen einen Hof verlässt. Dann grüne Bananen. Unmengen grüner unreifer Bananen. Und natürlich wurde das Ganze wieder von den getrommelten Rhythmen untermalt.
Trotz der wilden Bilderfolgen in der noch dazu überaus kurzen Nacht wachte Marie am nächsten Morgen in aller Frühe erfrischt auf. Der Wecker teilte ihr mit, dass sie nur vier Stunden geschlafen hatte. Doch sie fühlte sich mehr als erholt, voller Kraft und Tatendrang. Und zugleich erstaunlich klar im Kopf, erinnerte sie sich doch an eine Bilder- und Eindrucksflut, die in den wenigen Stunden Schlaf durch ihren Kopf geflutet waren.
Leise öffnete sie Klaras Schlafzimmertür und wie in stiller Absprache stand Willi bereits schwanzwedelnd vor der Tür. Marie hielt kurz den Atem an. Ja, sie hörte zwei unterschiedliche Schnarchgeräusche, obwohl die sich im Rhythmus schon ziehmlich aufeinander eingestellt hatten und sie genau hinhorchen musste. Fritz war also noch da. Marie freute sich für ihre Mutter. Vorsichtig zog sie die Tür hinter dem Hovawart zu.
Das eingespielte Frau-Hund-Team zog gutgelaunt zum Seeweg. Die Sonne war gerade aufgegangen und ihre Lichtstrahlen brachten die Tautropfen an den unzähligen Spinnennetzen auf den Wiesen zum Glitzern. Schon tausendmal gesehen – berührte Marie solche Naturästhetik immer wieder aufs neue. Erst der Morgentau machte die auf den Büschen, zwischen Kräutern und noch zwischen einzelnen dünnsten Grashalmen kunstvoll gefertigten Spinnennetze sichtbar. Ließ die Sonne am Morgen die feinen Wassertropfen verdunsten, verschwanden die meisten Netze wieder in die Dimension des Unsichtbaren. Dann nahmen die klebrigen Spinnenfäden wieder ihre Arbeit auf. Ihr Zweck war es bei weitem nicht, ausgerechnet Marie frühmorgens zu erfreuen. Sie waren Todesfallen für die mit der aufsteigenen Sonne hervorkommenden und mit ansteigender Temperatur munter werdenden Insekten: Mücken, Fliegen, Käfer, für all das zumindest für Marie kaum unterscheidbare Flieg- und Krabbelzeugs. Die Ästhetik war völlig sinnfrei, der Zweck verrichtete sich unsichtbar in unsichtbaren Gefilden. Obwohl – es war natürlich alles eine Frage der Perspektive. Für die Fliege, die sich nun die Nacht vom Leib putzte um gleich auf Nahrungssuche zu fliegen, war die Maries Tautropfenästhetik sicherlich vollkommen uninteressant. Sie würde möglicherweise einiges dafür geben, wenn die für sie so verfänglichen Seidenfäden auch den Tag über sichtbar blieben. Und ob sich eine Spinne an ihrem Kunstwerk erfreuen konnte? Ob sie das morgentlich Verfremden zum Kunstobjekt überhaupt wahrnehmen konnte?
Das Bewusstsein von Tieren. Gefühle. Seele. Eigenleben. Diese Kapitel wollte Marie nun wirklich nicht an diesem zauberhaften Morgen aufschlagen. Sie hob einen dicken Ast auf und schleuderte ihn zur Freude ihres vierbeinigen Begleiters weit hinein in den Spülsaum des Wittensees.
Aber dass etwas nur beiläufig und zweckfrei sichtbar wurde. Maries Gedanken schlugen nun ein anderes Kapitel auf. Wie der schwarze Hintergrund des ach so weißen Babys. Hier im Land der Weißen wäre das tote Baby beinahe einfach als ein toter Säugling unter gar nicht so wenigen Leidensgenossen durchgegangen. Ein ungewolltes Kind mehr, mit dem niemand wusste wohin. Das fallengelassen wurde, das nur noch auf irgendeine Art und Weise entsorgt werden musste. Wie bedroht es wohl tatsächlich gewesen war, wäre hier in Deutschland – um ein Haar im wahrsten Sinne des Wortes – unsichtbar geblieben.
In Tansania hingegen mochte der kleine Murundi überall großes Aufsehen erregt haben, mit seiner zart rosa-porzellanartigen, fast durchscheinenden Haut. Wie ein weißer Schwan unter lauter schwarzen oder umgekehrt. Und dann gierte ausgerechnet dort das menschliche Verlangen nach abergläubischen Amuletten und Glücksbringern. Und der kleine Kerl schrie schlicht mit seinem Dasein, seinem Atemholen, seinem Lächeln, seinem Brabbeln und seinem Lachen: Nehmt mich, ich bin das Besondere, ich verheiße Glück und Reichtum, selbst nicht im geringsten ahnend, was das überhaupt ist: Reichtum. Sein Leben, sein Dasein war all sein Reichtum.
Marie senkte kurz den Blick. Willi stand schon ungeduldig wedelnd mit dem apportierten Stock in der Schnauze vor ihr. Mit einem sanften „aus“ nahm sie dem Hund den Stock ab und warf ihn in das Waldstück auf der dem See gegenüberliegenden Seite des Strandweges. Dort hätte Willi mehr zu tun das Stöckchen wiederzufinden. Es machte dem Hovawart sowieso sehr viel mehr Spass, seine „Beute“ konzentriert zu suchen als sie laufend stumpfsinnig hin und her zu schleppen. Willi verfügte dabei über eine ungewöhnliche Ausdauer und Geduld.
War der Kleine von seinem Vater nach Deutschland gebracht worden, um hier in dem weißen Land sein Leben zu retten oder es wenigstens menschenwürdig zu halten? Die kleinen Finger wurden ihm wohl schon in Afrika abgenommen. Was machten die Menschen bloß damit? Hängten sich das um den Hals? Das konnte doch wohl nicht sein. Abkochen und dubiose Zaubertranke daraus machen?
Marie musste würgen. Sie warf erneut den Stock, den Willi viel zu schnell gefunden hatte, in das Walddickicht.
Marie gingen die abstrusesten Bilder durch den Kopf. Menschenknochen als Amulette waren noch die harmloseste Variante davon. Mit einem Mal schmeckte sie Blut. Marie spuckte vor sich in den hellen Sand des Wittensees aus. Farblos. Aber sie schmeckte es doch: Blut. Viel Blut. Es fühlte sich fast an, als wäre ihr ganzer Mund voll davon. Sie musste sich an der nächsten Parkbank festhalten, denn ihr wurde nun schwindelig. Sie wurde in große Höhen hinaufgetragen. Marie legte sich lang auf die Bank, weil sie Sorge hatte, sonst umzukippen. Sie war immer noch in großen Höhen, schwebte über etwas. Es war völlig gleichgültig, ob sie die Augen schloss oder versuchte, sie offen zu halten. Der Zustand blieb. Also machte Marie ihre Augen zu. Sie beschloss, wenn es nun sein sollte, so wollte sie ganz in diesen inneren Film oder wo sonst der herkam, einsteigen. Sie schwebte und stand gleichzeitig unter sich selbst. Die unten stehende Marie reichte der schwebenden einen goldenen Pokal entgegen. Die Schwebende, die ihrem Bewusstsein näher zu sein schien, griff nach dem Pokal, aber sie griff hindurch. Sie wedelte mit ihren Händen herum, aber konnte nichts berühren, weder den Pokal noch die Marie unter ihr. Diese blieb auch vollkommen unbeeindruckt von den Bemühungen der schwebenden Marie. Sie hielt den Pokal in die Höhe, murmelte unverständliche Worte, führte den Kelch dann zu ihrem Mund und trank daraus. Der Blutgeschmack in Maries Mund wurde fast unerträglich stark.
Das Blutopfer!
Marie schnellte von der flach auf der Bank liegenden in die mit ausgestreckten Beinen sitzende Position hoch. Um sie herum drehte sich alles. Sie selbst hatte schon Blutopfer gebracht. Sollte sie dafür jetzt Sühne tun oder eine Art Wiedergutmachung? Sie hatte doch letztens, als sie mit Helga was gemacht hatte, einem Tier, einer Ziege wohl, völlig ungerührt die Kehle durchgeschnitten. Deshalb hatte sie das getan. Sie trank das Blut! Und Marie war sich nicht mehr sicher, ob dies tatsächlich tierisches Blut war. Sie hatte Lebewesen geopfert. Sie würde nicht mehr die Hand dafür ins Feuer legen, ob die vier oder zwei oder sechs Beine gehabt hatten. War sie deshalb prädestiniert für diesen Fall? Das schien alles kein Zufall zu sein.
Marie war wieder in ihrem Verstand zuhause. Der Schwindel war einem gewaltig schmerzhaften Druck auf der Stirn, ihrem dritten Auge gewichen. In ihrem Kopf war nun der klare Gedanke, dass aus den Fingern des Kleinen ein ominöser Zaubertrank hergestellt worden war. Wahrscheinlich wurde der gegen gutes Geld hochverdünnt an die verzweifelte arme Bevölkerung des Landes verkauft.
Sie musste noch Mal zu Frau Soselo. Diese Erschütterung, dieses Entsetzen gestern in der sonst so kontrollierten Frau – die wusste genau um diese Vorgänge, hatte möglicherweise auch erst kurz zuvor von solchen Machenschaften erfahren. Wenn die Soselo nichts mit dem Tod des Kleinen zu tun hatte, so konnte sie ihr aber sicherlich als eine Frau und Mutter, die zumindest in Afrika verwurzelt war, auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Sie würde heute noch einmal nach Hamburg fahren, aber allein. Die Befragung müsste sich zu einem intimeren Gespräch von Frau zu Frau entwickeln können, von Mutter zu Mutter, von Entsetzter zu Entsetzter.
Marie setzte sich auf. Der Druck wich langsam aus ihrer Stirn. Willi. Wo war der Hund geblieben?
„Wiiiiilliiiiiii!“ rief Marie aus vollem Hals.
Und sofort kläffte es aus dem Unterholz. Marie krabbelte zwischen den Gebüschen hindurch. Da saß der Hovawart konzentriert und starrte in einen Weißdornbusch.
„Hoi, Willi, den hast du aber prima bewacht.“ Knapp zwei Meter über dem Boden hing der von Marie geworfene dicke Ast in den dornigen Zweigen des Weißdorns fest. „Na, ich hoffe, du warst klug und hast dich nicht gepiekt, mein Hund.“
Willi jaulte kurz auf. Klug sein fand er immer gut – oder sonstwie gelobt zu werden.
Marie nahm einen langen Ast vom Boden auf und schlug damit von unten und von der Seite Willis Beute wieder frei. In einem kleinen Bogen fiel der Ast der Begierde in Richtung Waldboden, wurde aber zuvor von Willis geschicktem Fang aufgefangen. „Siehst du, Willi. Deshalb heißt dein Fang Fang. Gut gemacht.“
Die Antwort wedelte Marie vergnügt entgegen.

25
Marie hatte sich nur schnell ein Frühstück im Stehen gemacht, selbstverständlich nach der Darreichung oder Herausgabe – je nach Standpunkt – des Futternapfes an Willi. Sie konnte sich gerade noch von ihrer Mutter verabschieden, nachdem sie kurz den Tagesablauf besprochen hatten. Gott sei dank war es ihr erspart geblieben, die junge Zweisamkeit stören zu müssen.
Sie wollte früh los, um so zeitig wie möglich in Hamburg zu sein. Zum einen würde das den Überraschunsgeffekt bei den Soselos erhöhen, zum anderen spekulierte sie darauf, an diesem Dienstag vielleicht auch noch ein paar Worte mit Herrn Soselo wechseln zu können, ehe der Wissenschaftler in sein Institut entschwand. Erfahrungsgemäß begann der Forschertag eine ganze Weile später als etwa der Bäckertag oder selbst als der Behördentag. Vielleicht hatte sie ja Glück. Dann könnte sie zwei Fliegen … nein, nicht schon wieder diese halb getarnten Gewaltausdrücke!
Eine Weile tat sich gar nichts, nachdem Marie die Klingel der Soselos gedrückt hatte. Als sie schon befürchtete, es könnte niemand im Haus sein, kam Maikel, den Marie aufgrund der Fotos sofort erkannte, aus dem Haus gelaufen. Ihm folgte Jeanine Kalika, la bonne d´enfants, das Kindermädchen, die ihr mit einem freundlichen „Bonjour, Madame“ zunickte, mit dem Kopf auf die offen gelassene Haustür verwies und selbst in morgendlicher „Ich-muss-das-Kind-pünktlich-in-den-Kindergarten-bringen“ – Hektik in den schwarzen Patrol einstieg, nicht ohne permanent „Maikel, dépêche tois, s´il vous plait!“ zu rufen.
Marie betrat etwas zögernd die schöne Holzvilla der Soselos. Sie klopfte sicherheitshalber noch einmal an die Tür, aus der sie Stimmen hörte, schob langsam die nur angelehnte Tür auf und trat in das Esszimmer ein.
Zwei erstaunte Augenpaare blickten ihr entgegen. Sie hatte also tatsächlich wieder einmal Glück. Herr und Frau Soselo saßen beide an einem übersichtlich elegant gedeckten Frühstückstisch.
„Guten Morgen, Frau Johannsson,“ begrüßte sie betont freundlich Frau Soselo.
Und zu ihrem Mann: „Sokwe, das ist die Kommissarin aus Rendsburg, von der ich dir erzählt habe.“
„Guten Morgen, Frau Johannsson!“ Sokwe Soselo war ein schlanker Mann mit eleganten Bewegungen. Er stand umgehend auf, legte seine Serviette auf seinen Stuhl und gab ihr mit einem offenen Blick die Hand.
„Guten Morgen, Herr Soselo.“ Marie blickte ihm direkt in die gutmütigen und klaren Augen. Und in Richtung Dame des Hauses: „Guten Morgen, Frau Soselo. Entschuldigen Sie bitte die frühe Störung, aber es sind noch ein paar wichtige Fragen aufgetaucht und ich erhoffe mir, dass Sie mir dabei weiterhelfen können.“
„Nehmen Sie doch bitte Platz, Frau Kommissarin.“ Herr Soselo rückte einen Stuhl vom Kopfende des langen Tisches ab.
„Gerne.“
„Möchten Sie vielleicht einen Kaffee mit uns trinken. Vielleicht ein Brötchen oder Croissant dazu.“
Oh, Marie liebte Croissants, diese fettige leichte Angelegenheit mit dem teils knusprigen, teils weichen Kaugefühl im Mund: „Gerne. Wenn ich wählen darf, bitte einen Kaffe mit Milch und ein Croissant.“
Es war Herr Soselo, der ihr den Kaffee einschenkte und das Croissant servierte. Über Frau Soselos Gesicht sah Marie kurz unleidliche Züge hinweghuschen.
„Was führt sie – außer den besten Croissants Hamburgs natürlich – zu uns?“ fragte Sokwe Soselo mit unbedarft wirkender Freundlichkeit.
„Es sind noch einige Fragen zum Mordfall an dem kleinen tansanischen Albinojungen aufgetaucht.“ Marie hatte absichtlich einige inzwischen bekannte Details um das tote Baby in ihren ersten Satz einfließen lassen, um die Reaktion vor allem des Mannes zu beobachten. Seine Gesichtszüge wurden für weniger als einen Augenblick ernst, wie es seine dunklen leuchtenden Augen sowieso waren, seit sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Johana Soselo behielt ihre Maske auf.
„Bitte fragen Sie!“ forderte der Wissenschaftler Marie auf.
Nachdem Marie den letzten Bissen des tatsächlich köstlichsten Croissants, dass sie je außerhalb von Frankreich gegessen hatte, heruntergeschluckt und mit dem ebenfalls nicht zu verachtenen vollmundigen Kaffee nachgespült hatte, begann Marie:
„Sie haben bei der ersten Befragung durch meinen Hamburger Kollegen einen Onkel erwähnt, können Sie sich erinnern? Können sie mir sagen, was es mit diesem Onkel auf sich hat? Ist er ein Mitglied ihrer Familie, vielleicht ihr Bruder oder ihr Onkel?“
Sokwe Soselo warf kurz einen fragenden Blick auf seine Frau, was sie mit gleichbleibender Miene beantwortete. Das stille Motto verkündend: Bleib gelassen und ruhig. Es ist alles ok.
„Ich kann mich nicht mehr an den Zusammenhang erinnern, in dem ich einen Onkel erwähnt haben soll. Meine beiden Onkel jedenfalls leben nicht mehr, von daher würde es mich wundern, wenn ich einen von ihnen in einer aktuellen Angelegenheit erwähnt haben sollte.“
„Und sonst?“ hakte Marie nach.
„Ich weiß sonst nichts von einem Onkel.“ Herr Soselo ruderte ein wenig mit seinen Blicken im Raum herum, zwischendurch beinahe Hilfe suchend seine Frau streifend.
„Ok.“ lenkte Marie ein. „Ist einem von ihnen beiden ein Mädchen mit dem Namen Lola, Leila, Lulu oder Lala oder auch so ähnlich bekannt? Höchstwahrscheinlich ein tansanisches Mädchen?“
„Laima, hieß so nicht…“ platzte es in dennoch leisem Tonfall aus Herrn Soselo heraus.
„Nein, Frau Johannsson!“ Nun schritt Johana Soselo energisch in den Befragungsverlauf ein, ehe ihr Mann in seiner offenen Art anscheinend zu viel preisgeben konnte. „Wir kennen kein tansanisches Mädchen, und daher auch keines mit einem Lola oder Lulu ähnlichen Namen. Was mein Mann sagen wollte, ist, dass er den Namen Laima kennt, der so ähnlich klingen mag. Aber dabei handelt es sich um den Vornamen der Großmutter eines guten Freundes von uns. Das kommt für ihren Fall ja wohl kaum in Frage. Ich glaube also kaum, dass wir ihnen weiter helfen können.“
„Stimmt, Laima Murundi,“ sagte Sokwe Soselo leise vor sich hin. Doch Marie geschultes Ohr hörte den ihr inzwischen vertrauten tansanischen Nachnamen.
Also doch, dachte sie, ohne sich die geringste Regung anmerken zu lassen. Denn schon wieder erhielt der Mann von seiner Frau einen strafenden Blick zugeworfen. Waren die Soselos also doch die Verbindung zu dem toten Baby und dessen Familie! Aber diesen Joker wollte sich Marie noch für später aufbewahren. Statt dessen ging Marie dazu über, die Atmosphäre am Tisch zu entspannen.
„Kennen sie überhaupt noch viele Leute in Tansania? Sie sind doch wahrscheinlich sehr beschäftigt hier, mit Beruf, Forschung, Kindern und Haus.“
Frau Soselo atmete sichtlich erleichtert tief durch: „Da haben sie recht. Ich bin ja nun auch in Hamburg geboren und für mich ist dieses Afrika fast so fremd wie es für Sie sein wird. Mein Mann fährt wenigstens alle zwei, drei Jahre rüber, um seine Eltern zu besuchen. Aber ich selbst war erst ein Mal dort, quasi zur Vorstellung als Schwiegertochter.“ Johana Soselos Tonfall hatte sich wieder auf freundlichem Niveau eingependelt. Wahrscheinlich war sie eine ganz nette und noch dazu eben sehr taffe Frau, die Marie gut gefallen hätte, wenn sie sich unter anderen Umständen kennengelernt hätten. Aber das war in ihrem Beruf häufiger so.
Sokwe Soselo wurde unruhig. „Ich muss los. Ich habe gleich einen sehr wichtigen Besprechungstermin zur Drittmittelbewilligung. Da geht es um viel Forscherzukunft, und nicht nur um meine, darum sogar am allerwenigsten.“
Herr Soselo neigte wohl stets dazu, alle seine Gedanken offen auszusprechen. Die meisten Männer, zumindest die, die Marie kannte, hätten diese Details nicht erzählt, sondern wären schlicht mit einem „Ich-muss-jetzt-los“ aufgestanden und gegangen. Sie sollte versuchen, Sokwe Soselo noch einmal allein zu erwischen.
„Kann ich sie noch irgendwie erreichen heute, wenn noch eine Frage auftauchen sollte?“
Herr Soselo griff in die Innentasche seines geschmackvollen beigen Leinenjaketts und fingerte eine Visitenkarte hervor.
„Hier, Frau Johannsson. Unter der Telefonnummer meldet sich meine Sekretärin. Die weiß aber immer wo ich bin. Nur vor zwölf Uhr heute hat es keinen Sinn, denn die Sitzung heute wird mindestens drei Stunden in Anspruch nehmen.“
Herr Soselo stand auf, küsste mit liebevollem Abschiedsritual seine Frau, die ihrem Mann noch etwas Marie Unverständliches zuflüsterte und verließ den Raum mit einem: „Auf Wiedersehen, die Damen. Ich wünsche einen schönen Tag.“
Kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss und die beiden Frauen saßen sich noch immer schweigend schräg gegenüber.
Marie überlegte, ob sie jetzt auf die sanfte oder die harte Tour weitermachen sollte. Sie entschied sich erst einmal für den zurückhaltenden Weg. Vielleicht konnte die einen Moment der Frauensolidarität nutzen. Sie würde es einfach probieren. Schließlich hatte sie schon in den ersten Sätzen hier im Haus mehr erfahren als sie hatte erwarten können. Und ihr Gefühl verriet ihr, dass es noch mehr werden könnte, wenn sie es nur geschickt genug anstellen würde. Vielleicht gelang es ihr noch, Frau Soselo ins Plaudern zu bringen.
„Diese Croissants, Frau Soselo, die sind wirklich außergewöhnlich gut. Woher bekomen sie die, wenn sie das verraten dürfen?“
Frau Soselo schaute Marie etwas verdutzt an.
Gut, das war ein etwas durchsichtig-plumper Versuch. Aber ich muss mich ja auch erst warmlaufen. Als echtes Nordlicht bin ich nun mal keine geborene Plaudertasche.
„Die kleine Bäckerei Hansen in Othmarschen, liegt etwas versteckt hinter dem S-Bahnhof, die macht die. Die machen alle ihre Sachen noch selber und sind ein echter Geheimtipp. Möchten Sie noch Kaffee?“
„Danke, gerne. Gut, das werde ich mir merken. Wenn ich mal in der Gegend bin.“
Marie geriet innerlich unter Druck und in Stress, weil sie das Schweigen zwischen ihnen unterbinden musste, um nicht noch mehr Spannung entstehen zu lassen.
„Sie sind als Diplomatentochter hier in Hamburg geboren und aufgewachsen?“ begann Marie vorsichtig.
„Ja, wie Sie wissen.“
Es lag noch etwas Abweisendes in Frau Soselos Stimme.
„Darf ich fragen, wie sie ihren Mann kennengelernt haben?“
„Dürfen Sie. Nun, ich habe nach dem Abi Biochemie studiert. Ich war zwar eine zeitlang im Ausland – um ihnen die Frage zu ersparen, ja in Afrika, genauer gesagt in Südafrika, in Kapstadt. Aber kennengelernt habe ich meinen Mann hier in Hamburg. Ich hatte hier gerade eine Doktorandenstelle angenommen und er war bereits fertig und als Stipendiat in einem Sonderforschungsbereich tätig. Nun ja, und zwei Schwarze fallen sich da schon schnell ins Auge.“
Nun konnte Marie versuchen einzuhaken: „War es für Sie schwierig, hier in Hamburg als dunkelhäutiges Kind aufzuwachsen? Die Hanseaten sind ja einerseits weltoffen, anderereits aber auch sehr konservativ und eher gegen zu viel Fremdes abgeschottet.“
„Nun, die kleinen Negerbabys finden ja alle noch sehr niedlich. Und wenn das kleine Mädchen hübsch ist – und da hatte ich Glück – dann geht das auch noch ein Weilchen so weiter. Je älter ich wurde, desto skeptischer wurden dann allerdings auch manchmal die Blicke. Aber ich bin ja zum großen Teil im Umfeld der Botschaft aufgewachsen. Da war das Nebeneinander von schwarzer und weißer Hautfarbe ganz normal.“
„Und außerhalb des Botschaftsbetriebs?“
Marie merkte, dass sie sich weit vor wagte: „Entschuldigen sie bitte, wenn ich so intensiv nachfrage. Das hat mich persönlich immer schon interessiert.“
Und das war nicht gelogen. Marie fragte sich, wie es für einen Menschen wohl sein würde, in seinem Umfeld stets und immer aufzufallen, weil man anders war, und zwar unkaschierbar anders. Das hatte Marie bereits seit Jahren beschäftigt – lange vor diesem Albino-Fall.
Bei Frau Soselo schien das ehrliche, persönliche Interesse der Kommissarin anzukommen: „Wenn man immer nur Weiße um sich herum sieht, kann der Verstand schnell vergessen, dass die eigene Hautfarbe schwarz ist. Dann fühle ich mich – damals wie heute – schlicht und ergreifend als eine echte und völlig normale Hamburger Deern. Bis mich wieder irgendjemand so komisch anguckt, so als würde etwas nicht zusammenpassen, weil ich etwas gesagt oder getan habe, was nur eine echte Hamburgerin sagen oder tun kann. Dann kriegt mein Gegenüber es wieder einmal nicht übereinander, dass aus einer Eingeborenen aus einem afrikanischen Gral – eine Schwarze und noch dazu eine Frau – vermeintlich kultivierte Bemerkungen zur Qualität des Saltimbocca bei Fredericci oder Erklärungen zur Kohlendioxidfixierung im langsam auftauenden sibirischen Permafrostboden kommen. Sie müssen wissen, ich habe dazu Grundlagenerkenntnisse im Rahmen meiner Promotion geliefert. Und ich bin den klassischen Weg einer Hamburger Deern gegangen: Als Maikel kam, habe ich meine wissenschaftliche Laufbahn abgebrochen, meine Assistentenstelle aufgegeben und ganz selbstverständlich auch meine Habilitation zunächst auf Eis, und bald ins ewige Eis gelegt. Während Sokwe – mein Mann – gerade erst mit seiner Habil loslegte. Ich habe ihn natürlich unterstützt und ihm auch fachlich geholfen. Die kluge Frau im Hintergrund. Und doch stecken mich immer wieder Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, in ihrem Kopf zurück in die Hotelküche, wo ich das Geschirr sauber zu machen habe. Sei unsichtbar und diene uns, denn du bist eine schwarze Frau. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in den weißen Köpfen noch die Zeiten der Sklaverei aktiv herumspuken, als ob uns dieses Karma niemals loslassen würde.“
„Danke, ehrlich mein persönliches Dankeschön, dass Sie mir das so ausführlich erzählen.“
Marie meinte es ehrlich. Und zum ersten Mal seit sie sich kannten, tauschten die beiden Frauen einen warmen und offenen Blick aus. Es gab etwas wie Wertschätzung zwischen ihnen beiden – gefühlt schon die ganze Zeit, aber nun auch zum Ausdruck gebracht. In ihrer Mischung aus klarem Verstand und Mut schienen sie einander sogar ein wenig ähnlich.
„Darf ich nochmal dienstlich werden?“ Marie wollte das gewonnene Zutrauen der Frau nicht aufs Spiel setzen.
„Das müssen sie wohl, Frau Johannsson,“ antwortete Frau Soselo schon in deutlich moderaterem Ton als noch vor zwanzig Minuten.
„Wissen Sie von den Ritualen und Machenschaften um Albinos, in Tansania vor allem?“
Augenblicklich überzog ein Ausdruck des Entsetzens und großer Panik das Gesicht von Johana Soselo.
„Leider ja. Oder Gott sei dank. Nie wieder werde ich einen Fuß auf diesen Kontinent setzen. Unglaublich ist das. Barbarisch. Ich kann es bis heute nicht fassen, dass Menschen so etwas tun können. Ihre eigenen Landsleute, manchmal sogar Mitglieder der eigenen Familie.“
Ja, wie vielleicht auch der ominöse Onkel, dachte Marie.
„Und seit Juma auf der Welt ist…“ Frau Soselo schlug um Fassung ringend die Hände vor ihr Gesicht.
„Ich hätte so etwas auch nicht für möglich gehalten. Wahrhaftig nicht,“ solidarisierte sich die Mutter von Lukas mit der Mutter eines Albino-Jungen. „Doch Menschen, deren Geist irre geleitet ist und die den Kontakt zu ihrem Herzen verloren haben, sind zu den unvorstellbarsten Greueltaten fähig – und nicht nur in Afrika. Wir in Deutschland wissen sehr wohl darum, was es heißt, bestimmten Menschen – warum auch immer – ihre Menschenrechte abzusprechen und sie der Willkür auszusetzen. Wenn die Verbindung zum Herzen, wenn das Mitgefühl gekappt ist, kann der Menschen dem Menschen offenbar alles tun. Seine vermeintliche Freiheit, Willensfreiheit, artet viel zu häufig in Grausamkeit aus.“
„Mmmmhhh.“ Frau Soselo sinnierte vor sich hin.
Marie ließ ihr ein wenig Zeit.
Dann fuhr sie fort: „Wissen sie mehr darüber, wie das praktisch ausgeführt wird. Ich meine, nur falls sie darüber reden können und wollen. Sie würden mir sehr helfen. Ich muss versuchen dieses Unvorstellbare zu verstehen. Bitte helfen sie mir! Denn sie möchten bestimmt genauso wenig wie ich, dass der Tod des kleinen Albinojungen ungesühnt bleibt. Bitte!“
Frau Soselo schaute Marie sehr direkt an. Die Herzen der beiden Mütter berührten einander. Ob es das war, was Frau Soselo veranlasste zu erzählen, wusste Marie nicht.
Es war jedoch deutlich zu spüren, dass sich Frau Soselo einen gewaltigen Ruck geben musste, sich an die ganzen Geschichten zu erinnern, die sie über die abergläubischen Zauberrituale um Albinos gehört hatte. Obwohl sie sich mehrmals räusperte, musste sie noch mehrmals anstoßen, ehe sie die ersten Worte herausbrachte:
„Ok. Fangen wir mit vergleichsweise harmlosen Geschichten an. Man nimmt Albinohaare und flicht sie in die Fischernetze ein. Das soll – wie ja alles von Albinos – Glück bringen. Das ist vor allem am Viktoriasee sehr beliebt und wird angesichts der immer mager werdenden Ausbeute der Fischer dort zunehmend polulärer.“
Marie erinnerte sich, dass die Stadt, aus der die drei Murundis gekommen waren, möglicherweise die Geburtsstadt des kleinen toten Jungen, direkt am Viktoriasee lag. Musana oder so ähnlich. Sie konnte sich den Namen nicht merken.
„Die Leute dort verstehen nicht, dass der dramatische Rückgang der Fischbestände eine Folge der Überfischung wegen des Viktoriabarsch-Hungers der westlichen Welt ist. In solchen Dimensionen sind die einfachen Menschen dort gar nicht gewohnt zu denken. Sie glauben, wie seit Generationen, an Medizinmänner und darunter natürlich immer auch zahlreiche Quacksalber und heute zunehmend auch gewissenlose Kriminelle, die die alten Traditionen für ihre Geschäfte ausnutzen. Die existenzielle Verzweifelung der Fischer tut ein übriges, sie in die Fänge rücksichtsloser krimineller Geschäftemacher zu treiben. Wir hier bekommen von der verzweifelten Lage dieser Menschen gar nichts mit. Es ist uns auch egal, solange der Viktoriabarsch auf unserem Teller schön glasig gebraten ist.“
Marie ergänzte betroffen: „Es ist wieder unsere Gier und Bedenkenlosigkeit, unser Nicht-wirklich-kümmern oder unsere Rücksichtslosigkeit, die Unheil stiftet. Ich wusste das gar nicht, mit der Überfischung des Viktoriabarsches. Als ich noch Fleisch und Fisch gegessen habe, war Viktoriabarsch einer meiner liebsten Fischsorten, weil er so schön fest und schmackhaft ist, und zudem nicht so teuer war. Aber dass der ein Süßwasserfisch ist. Ich habe mich über den Namen gewundert, aber dass der tatsächlich aus diesem riesengroßen See in Afrika kommt, war mir nicht klar.“
Frau Soselo legte noch nach: „Wir reichen Nationen haben sogar noch mehr damit zu tun. Im Rahmen von Entwicklungshilfemaßnahmen wurde der Fisch, der eigentlich Nilbarsch heißt, weil er ursprünglich nur in diesem Flussgebiet vorkam, im Viktoriasee ausgesetzt. Dort hat er sich so rasant vermehrt, dass er die gesamte heimische Fauna durcheinandergebracht hat. Vor allem die für den gigantischen See charakteristischen Buntbarsche wurden zum größten Teil ausgerottet. Die einheimische Trockenfischindustrie, die von diesen Buntbarschen lebte, ist inzwischen völlig ruiniert. Und das ganze wurde überhaupt erst mit Mitteln der EU als Entwicklungsprojekt möglich.“
Marie war fassungslos.
„Und stellen Sie sich vor: das ist der zweitgrößte Süßwassersee der Welt. Mit was für ökologischen Dimensionen wir es dort zu tun haben. Viele, viele Millionen Menschen leben an den Ufern des Sees. Die ganzen tradierten Lebens- und Überlebensformen hat diese völlig unreflektierte Entwicklungshilfe aus dem Lot gebracht. Guter Wille alleine reicht nicht, schon gar nicht vermeintlich guter Besserwisserwille. Aber der See leidet noch unter anderen Problemen, vor allem unter wachsender Umweltverschmutzung.“
Marie wollte die gerade in Schwung gekommene Frau nicht bedrängen. So schaute sie Frau Soselo stumm aber intensiv fragend an.
„Gut. Sie wollten noch mehr über die Praktiken um die Albinos erfahren.“
„Bitte!“
„Das wird aber immer ziehmlich unappettitlich. Sind Sie wirklich sicher?“
„Ich muss und ich will, Frau Soselo.“
„In erster Linie werden Zaubertranke hergestellt. Ja, man kann das kaum glauben, wenn man hier in Deutschland lebt. Da werden abgehakte Finger und Beine von den armen Menschen gekocht und das Ganze nachher als glückbringender Zaubertrank verkauft – zu horrenden Preisen versteht sich. Besonders intensiv und stark soll neben den auffälligen Haaren der Albinos vor allem die helle Haut wirken.“
Frau Soselo brachte die Worte nur stockend und mit Pausen der Fassungslosigkeit und des Entsetzens hervor.
Aha, daher der enthäutete Finger, den wir in Rendsburg gefunden haben. Marie schüttelte es innerlich. Dennoch, Marie versuchte, nun das ganze wieder auf eine abstraktere, auf eine Sachebene zu bringen: „Wo kommt denn dieser Aberglaube her? Worauf begründet der sich? Nur weil diese Menschen so auffällig anders aussehen?“
„Da liegen sicherlich die ursprünglichen Gründe für die große Aufmerksamkeit, die den Albinos in Afrika seit jeher entgegengebracht wurde. Sie müssen wissen, unter Schwarzen treten Albinogeburten etwa doppelt so häufig auf wie unter Weißen.“
„Ach!“
„Das heißt, die Albinos waren seit jeher auffällig, ganz klar, und auch rar genug, um als etwas Besonderes zu gelten, aber andererseits auch nicht rar genug, um schlicht als Außenseiter abgestempelt und vielleicht aus dem Gemeinschaftsleben ausgestoßen zu werden. Im Gegenteil hat man in vielen ethnischen Gruppen gerade Albinos zu Führern und Königen gemacht. Ihnen wurde eine besonders hohe Achtung zuteil. Sie genossen ein hohes Ansehen und stellen nahezu auf dem gesamten Kontinent ausgesprochen viele Stammesoberhäupter und Medizinmänner.“
„Wie konnte es denn ihrer Meinung nach zu dieser Wandlung im Umgang mit diesen Menschen kommen?“
„Es ist die Gier. Es ist der Verlust der alten Traditionen gekoppelt mit der kurzfristigen Gier nach Reichtum, nach Bequemlichkeit und im Falle der Fischer vom Viktoriasee, der Weigerung, Gegebenheiten anzuerkennen und sich ihnen anzupassen, sich umzustellen, sich zu verändern. Achtung, Wertschätzung und Würde sind aus den unterschiedlichsten Gründen verloren gegangen. Und dann hat sich Willkür und Menschenverachtung Tür und Tor geöffnet. Das ist ja leider überall auf der Welt so.“
Und nach einer Pause fügte Frau Soselo betroffen hinzu: „ In manchen Regionen werden Albinos heute regelrecht gejagt. Sie werden bei lebendigem Leib verstümmelt. Man hackt ihnen einfach irgendwelche Körperteile ab und verschwindet einfach damit, um sie auszukochen und damit schnelles Geld zu machen. Das ist so unglaublich und entsetzlich!“
Johana Soselo traten die Tränen in die Augen. Sie verbarg ihr tränenüberströmtes Gesicht in ihren Händen. Auch Marie fehlten die Worte. Sie wusste, dass die taffe Frau ihr gegenüber an ihre Grenze gegangen war und ihr Möglichstes getan hatte, um ihr zu helfen. Und dann als Mutter selbst ein solches Kind in den Armen zu halten musste das Wissen um solche Vorgänge schier unerträglich machen. Selbst Marie war ja schon sprachlos vor Entsetzen.
Die beiden Frauen schwiegen eine Weile zusammen, ehe sich Frau Soselo wieder fasste.
„Deshalb ist Herr Murundi mit seinem Sohn nach Deutschland gekommen.“
Frau Soselo blickte Marie fragend an.
„Die hatten dem Kleinen schon beide kleinen Finger entfernt.“
Frau Soselo schlug die Augen nieder und kehrte zu ihrer verhaltenen Haltung zurück: „Ich keinen keinen Murundi.“
„Der Vater muss mit seinem Jungen regelrecht geflohen sein.“
„Ja, das wird er wohl.“
Sie schien einen Murundi wirklich nicht zu kennen oder konnte gut schauspielern. Marie war sich nicht sicher, tendierte aber momentan zur ersten Erklärung.
Frau Soselo schaute Marie unmittelbar in die Augen: „Glauben Sie mir, Frau Kommissarin, ich kenne keinen Murundi. Ich kenne auch keinen anderen afrikanischen Mann, der mit seinem Albinojungen vor den Menschenjägern aus Tansania nach Deutschland geflohen ist. Glauben Sie mir einfach. Das Unglaubliche vorhin haben Sie ja auch geglaubt.“
„Ok, ok. Gut, ich glaube Ihnen ja. Aber Sie müssen schon zugeben, dass uns ein wenig zu viele Zufälle zu Ihnen geführt haben!“
„Aber wenn ich das richtig verstanden habe, doch letztlich nur, dass unser Jumo etwa genauso alt ist wie dieser unglückliche kleine Wicht!“
Und dann ergänzte die ehemalige Wissenschaftlerin in der Mutter: „Und bedenken Sie, dass im afrikanischen Genpool Albinos doppelt so häufig vorkommen wie im mitteleuropäischen.“
„Sie werden wohl recht haben,“ lenkte Marie ein. Sie war so dankbar, dass ihr Frau Soselo von dem Umgang mit den Albinos in Afrika und den ihr bekannten Hintergründen erzählt hatte.
So bedankte sich Marie – vielleicht etwas überschwenglich, weil ihr das Entsetzen über das eben Gehörte noch so in den Knochen saß – bei Frau Soselo und verabschiedete sich von ihr, nicht ohne ihrer Familie, besonders ihrem Sonnenschein Jumo, alles Gute zu wünschen.
26
Marie war noch kurz bei ihren Hamburger Kollegen vorbeigefahren. Doch viel Neues hatten Gabi und Robert in der kurzen Zeit noch nicht herausfinden können. Gabi hatte noch einige Namen auf ihrer Passagierliste von der Mayflower offen, um sie nach den Murundis zu befragen. Die Passiere, die sie bislang befragt hatte, konnten sich zwar an einen Mann mit einer etwa acht Jahre alten Tochter erinnern, aber nicht an ein Baby, schon gar nicht an dessen Hautfarbe. Aber sie konnten immerhin bestätigen, was die Kommissarinnen schon vermutet hatten, dass Imbakwe Murundi und seine Tochter beide dunkelhäutig waren. Das war ja immerhin schon etwas. Einige andere Passagiere von ihrer Liste hatte Gabi Schlieper bislang noch nicht erreicht. Zu der Besatzung hatte sie noch keinerlei Kontakt bekommen, weil das Containerschiff bereits wieder im Indischen Ozean zwischen dem schwarzen Kontinent und Madagaskar unterwegs war. Hoffentlich fiel das nicht noch somalischen Piraten in die Hände.
Robert hatte sich im Umfeld der Soselos auf die Suche nach den Murundis gemacht, war aber auf nichts weiter als eine Mauer des Schweigens gestoßen. Dass Frau Soselo Marie gegenüber das Kennen eines Murundi oder einer solchen Familienkonstellation – Vater mit zwei Kindern – mit anderem Namen bestritt, passte in diese geschlossen wirkende Abwehr gegenüber der deutschen Polizeibehörde. Dennoch wurden sich alle drei Ermittler immer sicherer, dass der Schlüssel zu dem Fall bei den Soselos lag.
Es war schon wieder Mittag geworden. Marie wollte noch kurz bei Sokwe Soselo vorbeischauen, ehe sie zurück nach Rendsburg fuhr. Vielleicht hatte sie noch einmal Glück heute und konnte den gesprächigen Wissenschaftler endlich einmal alleine erwischen.
Sie kehrte kurz bei einem indisch-vegetarischen Mittagstisch ein, wo sie sich ihr bislang köstlichstes Seitan-Gericht zu Gemüte führte
.
Soselos Visitenkarte entnahm sie eine Büro- und Sekretariatsadresse im Botanischen Institut in Klein Flottbek.
Und Marie hatte tatsächlich ein zweites Mal Glück heute. Just in dem Moment, als die freundliche Sekretärin zu einer professionellen Abwimmelung ansetzen wollte – der Herr Professor sei nach einer langen Sitzung zu Tisch und sie wüßte nicht, wann … – kam der smarte Wissenschaftler schwungvoll durch die Sekretariatstür.
Sokwe Soselo begrüßte Marie erneut sehr freundlich und bat sie sogleich in sein Büro: „Das haben Sie aber gut abgepasst, Frau Johannsson. Denn ich habe erst in einer halben Stunde meinen nächsten Termin. Darf ich Ihnen etwas anbieten?“
„Oh. Ich hätte gerne Wasser. Ich bin nun schon den ganzen Tag unterwegs, und da trinke ich immer zu wenig. Und noch dazu meist zu viel Kaffee. Vor allem, wenn der so köstlich ist wie Ihrer heute morgen.“
„Gerne.“
Herr Soselo stand auf, holte aus einer Kiste neben einem Büroschrank eine Flasche Volvic und stellte sie mit einem Glas vor Marie ab.
„Ich hoffe, meine Frau konnte Ihnen noch weiterhelfen?“
Marie war sich nicht sicher, ob Herr Soselo tatsächlich eine gewisse soziale Naivität an den Tag legte oder ob er nicht doch ein völlig ausgebuffter Taktiker war.
„Oh ja,“ antwortete Marie ruhig. „Ihre Frau hat mir einiges von den Praktiken um den Wunderzauber und die kriminellen Machenschaften um die afrikanischen Albinos erzählt.“
„Ja, sie hat sich mit diesem Aberglauben und seinen grausamen Auswüchsen beschäftigt – und seit Jumo da ist natürlich noch viel intensiver geworden.“
„Können Sie mir noch etwas über Laila oder Laima Murundi erzählen, Herr Soselo. Das war die Großmutter eines Freundes von Ihnen, sagten Sie?“ Marie wollte die halbe Stunde so gut wie möglich nutzen.
„Da gibt’s gar nicht viel zu erzählen. Laima war die Großmutter eines Schulfreundes von mir. Eine sehr nette und weise alte Dame, die ich immer sehr gemocht habe. Sie müssen wissen, meine Großmutter väterlicherseits ist schon sehr früh gestorben. Die habe ich nie kennengelernt. Und die Großmutter meiner Mutter wohnte sehr weit von uns entfernt, so dass ich als Kind kaum etwas von ihr hatte. Großmütter spielen in unserer Kultur, in unserem alltäglichen Leben eine große Rolle. Sie sind für die meisten Kinder ein wichtigerer Anlaufpunkt als die Mütter, die früher auf dem Feld, heute in Fabriken oder Büros, für den Unterhalt der Familie arbeiten und Geld verdienen müssen. Meine Mutter war da keine Ausnahme. Zwar gehörten wir nicht zu den armen Leuten in Pisiansi, immerhin war mein Vater einer der ersten Schwarzafrikaner, der im hiesigen Institut nicht nur saubermachen, sondern auch an der Datenaufnahme zu Forschungszwecken arbeiten durfte. Aber es ist in Tansania Tradition, dass die Frau nicht zuhause herumsitzt, wenn sie nicht gerade Essen kocht und sauber macht. Deshalb hat meine Mutter auch gearbeitet. Ich habe mir unter meinen Schulkameraden gewissermaßen eine Ansprechgroßmutter gesucht, weil ich doch viel allein war. Und das war die tolle Großmutter meines Freundes Ismail. Ach ja, stimmt. Sie haben ja nach einem Vater mit Namen Murundi gefragt. Ismail und seine Großmutter hießen beide Murundi. Aber dieser Name ist in Tansania einer der häufigsten Familiennamen, noch sehr viel häufiger noch als hier in Deutschland die Meiers.“
„Gut, dann kennen Sie also einen Mann, der Ismail Murundi heißt, mit einer Großmutter, deren Vornamen Laima lautet?“
„Ja. Aber auch Laima ist ein sehr häufiger Frauennamen.“
„Ist Ihnen denn irgendwann auch einmal der Vorname Imbakwe unter den vielen Murundis begegnet, die Sie kennen?“
„Nein, ich kann mich nicht erinnern. Und Imbakwe ist nun tatsächlich einmal ein ungebräuchlicher Name, jedenfalls für Tansania.“
Marie schoss eine Idee durch den Kopf: „Kommt der Vorname Imbakwe zufällig aus Ghana, wissen Sie das?“
„Das ist gut möglich, ja. Im ostafrikanischen Raum ist der Vorname jedenfalls sehr selten. Er kann übrigens auch ohne das „i“ vorweg geschrieben und gesprochen werden, also mit äm, be, a, ka, we und ee. Bei uns wird ein Eingangs-i sowieso nicht so stark betont wie etwa im Deutschen.“
„Wenn wir schon in Ghana sind, Herr Soselo. Können Sie mir sagen, wie verbreitet oder populär Adinkra ist? Meines Wissens kommt diese alte Symbolsprache ursprünglich aus Ghana.“
„Ja, Adinkra ist eine alte Symbolsprache der Ashanti, einer ethnischen Gruppe in Westafrika, die bis etwa Anfang des 19. Jahrhunderts ein stattliches Königreich auf dem heutigen Boden Ghanas innehatte. Sie haben sich allerdings auf dem Kontinent nicht sehr beliebt gemacht: Die Ashantis entführten Menschen, die in den umliegenden Staaten lebten und verkauften sie als Sklaven an die Europäer. Noch heute stellen die Ashanti mit ihren Siedlungen eine zentrale Region in Ghana.“
„Das ist ja interessant. Ich meine das mit dem Sklavenhandel. Dann werden die Ashanti doch bestimmt auch Leute gehabt haben, die sich auf schwarze Magie verstanden haben. Wissen Sie vielleicht auch darüber etwas?“
„Sie meinen wegen des dunklen Sklavenkapitels?“
„Ja, ja!“
„Dennoch: Trotz des für die Könige und Herrscher einträglichen Sklavenhandels waren die Ashanti eine der wenigen afrikanischen Ethnien, die sich überhaupt der Kolonialisierung energisch und mit Gewalt wiedersetzt haben. Erst zur letzten Jahrhundertwende mussten sie sich der militärischen Übermacht der Briten geschlagen geben.“
Herr Soselo dachte kurz nach. „Aber Sie haben recht, Frau Johannsson. Ich kenne diese Schriftsprache, diese einfachen, aber sehr eindringlichen Adinkra-Symbole auch als Zauberzeichen. Die wurden für Beschwörungsformeln benutzt. Stimmt…“
Sokwe Soselo schien sich an eine Begebenheit aus seiner Kindheit zu erinnern und schmunzelte: „Ja, genau. Als Kinder haben wir immer ein ganz bestimmtes Zeichen benutzt, wie hieß das noch gleich? Ja – mpuannum. Das waren fünf Kreise – einer für jeden von uns, denn wir waren fünf Jungs, die immer miteinander gespielt haben. Diese fünf Kreise waren angeordnet wir auf einem Würfel, einer in der Mitte und vier drumherum, nur dass sich unsere fünf Kreise alle berührt haben. Ich glaube, wörtlich heißt dieses Symbol „fünf Haarbüschel“. Es wird aber wie die meisten Adinkra-Symbole übertragen eingesetzt und steht dann für Loyalität und geistige Geschicklichkeit. Das fanden wir Jungs damals natürlich toll, zusammenhalten wie Pech und Schwefel – so sagt man hier in Deutschland dafür, wenn ich mich nicht irre.“
Marie stimmte nickend zu.
„Mein Vater erklärte mir später, dass dieses Adinkra eine alte Zaubersprache sei, und das wir damit sehr vorsichtig sein sollten, um keine bösen Geister herbeizurufen. Dass wir einen Jungenbund geschlossen hatten und dicke Freunde waren, fand natürlich die volle Zustimmung meines Vaters. Aber er warnte uns davor, dass es passieren könnte, dass wir fünf Freunde auf ewig aneinandergekettet seien könnten, wenn wir dieses kraftvolle Symbol nicht achtsam genug oder gar falsch einsetzen würden. Denn die Haarbüschel bezogen sich auf eine traditionelle Priesterfrisur, waren also sehr eng mit den Magiekundigen verwoben. “
„War ihr Schulfreund, der Ismael Murundi auch in dieser Fünferclique?“
„Ja sicher. Ismael war mein bester Freund.“
„Und hat Ismael einen Bruder?“
„Nun ja. Ich bin vor über 20 Jahren aus Pisiansi weggegangen und habe Ismael aus den Augen verloren. Er hat den Ort auch verlassen. Seine Großmutter war schon zuvor gestorben. Und ob Ismaels Mutter noch einen Jungen zur Welt gebracht hat, das weiß ich nicht. Ismael war der älteste Sohn, überhaupt das erste Kind und hatte eine sehr junge Mutter.“
Nach Maries Dafürhalten schien Herr Soselo ihr ehrlich zu antworten.
Herr Soselo schaute auf seine Uhr und wurde unruhig: „Ich muss jetzt gleich los. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, machen Sie doch am besten einen Termin mit meiner Sekretärin. Die verwaltet mein Dienstleben sehr gut. Ich funktioniere nur in dem von ihr geschaffenen System. Und dazu muss ich jetzt den Ort wechseln.“
Okwe Soselo lachte ein breites offenes Grinsen.
„Ich danke Ihnen, Herr Soselo. Sie haben mir ein gutes Stück weiter geholfen.“
„Gerne helfe ich. Soll ich Sie noch ein Stück mitnehmen?“
„Gerne.“
Das ungleiche Paar – die einachtzig große, kräftige blonde Frau und der zwar etwa ebenso große, aber sehr feingliedrige und mit ungewöhnlich eleganten Bewegungen ausgestattete Schwarze – ging zügigen Schrittes den langen Institutsflur in Richtung Ausgang entlang.
„Wo liegt eigentlich ihr Geburtsort, Herr Soselo?“
„Pisiansi liegt direkt am Viktoriasee, drei bis vier Kilometer vom Stadtkern von Mwanza entfernt. Gehört heute zu Mwanza. Wir haben dort als Spezialität Rührei mit eingebackenen Pommes gegessen, können Sie sich das vorstellen? Da war nicht nur für uns Kinder eine unglaubliche Köstlichkeit, das ist fast bis heute eine tansanische Spezialität. Eine der vielen absurden Hinterlassenschaften der englischen Kolonialtage.“
Herr Soselo lachte über sein ganzes freundliches Gesicht.
Dieser Mann hat bestimmt eine glückliche Kindheit gehabt, dachte Marie, die von Sokwe Soselos Gelassenheit und Fröhlichkeit ganz angesteckt war. Sie konnte sich den ausgelassenen Jungen gut vorstellen, wie er sich mit großer Freude über eine große Portion Rührei mit eingebackenen Pommes hermachte.
Herr Soselo blieb stehen: „Ich muss mich jetzt hier von Ihnen verabschieden. Ich muss jetzt hier abbiegen. Wenn Sie diese heiligen Hallen verlassen wollen, sollten sie dort hinten rechts die Treppe heruntergehen, dann sehen Sie schon den Ausgang.“
„Danke. Und vielen Dank auch für Ihre Informationen und dass Sie mir Ihre kostbare Zeit geschenkt haben. Auf Wiedersehen, Herr Soselo. Und viel Erfolg noch für Ihre Drittmittel!“
„Ich danke Ihnen auch. Ich habe mich gerne an meine Kindheit erinnert. Und es freut mich, wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte. Auf Wiedersehen, Frau Johannsson.“
Nach einem höflich-freundlichen Händeschütteln gingen die beiden in ihre verschiedenen Richtungen auseinander.
Auf der Autobahn Richtung Norden ging Marie die ganze Informationsflut durch den Kopf, die sie heute von den Soselos erhalten hatte. Es war gut gewesen, heute morgen ihrem spontanen Einfall zu folgen und früh nach Hamburg zu fahren, um die beiden möglichst alleine zu erwischen. Ein Gespäch unter vier Augen hatte fast immer eine andere Qualität als mit mehreren Personen.
Ihre Freundin Helga würde wieder sagen, dass sie gut geführt worden war. Marie verstand nicht, wer das sein sollte, der sie da durchs Leben führen sollte, irgendwelche Geister, irgendwelche toten Seelen, womöglich Engel? Und ausgerechnet um ihre Belange sollten die sich kümmern? Aber sie hatte schon mehr als einmal das Gefühl gehabt, dass da etwas außerhalb von ihr war, was ihr auf die Schulter klopfte und klar sagte, was sie jetzt besser tun und manchmal auch besser lassen sollte – symbolisch gemeint natürlich. Wenn ihr tatsächlich ein womöglich noch geflügelter Zwei-Meter-Engel auf die Schulter klopfen würde – Marie wusste gar nicht, ob sie das überhaupt aushalten würde. Diese permanenten Ahnungen in ihrer Familie, zunächst von ihrem Vater, von ihrem Großvater ja wohl auch, und nun auch so klipp und klar und auch noch zutreffend von ihrem Sohn – das reichte ihr erst einmal. Sie selbst schien ja wohl auch nicht ganz frei davon zu sein. Gut – sie traf manches Mal unorthodoxe Entscheidungen, die sich im Nachhinein als unbedingt goldrichtig entpuppten und die sie sich mit ihrem Verstand nicht erklären konnte. Nicht einmal die weibliche Intuition, von der Marie sehr viel hielt, konnte bei solchen Vorkommnissen immer als Erklärung herhalten.
Wie üblich schüttelte Marie solche Gedanken mit einem Man-muss-ja-nicht-alles-verstehen aus ihrem Kopf. Diese intellektuelle Beschwichtigung wurde allerdings immer halbherziger. Denn Maries ungewöhnliche Erfahrungen häuften sich nun doch ziehmlich auffällig in der letzten Zeit, sie nahmen einen immer größeren Raum in ihrem Leben ein. Und Marie war beileibe keine Frau, die sich einfach so bewusstlos durch ihr Leben, durch ihren Alltag treiben lassen konnte. Sie wollte schon mehr verstehen und Zusammenhänge begreifen, doch sie merkte, dass sie an dieser Stelle extrem vorsichtig und zurückhaltend war.
Ich glaube, ich habe richtig Angst vor dieser Unfassbarkeit, vor dieser geistigen Dimension, vor all dem, was ich nicht anfassen, nicht mal begreifen, verstehen oder auch nur sehen kann, ging es Marie – noch immer auf der Autobahn – durch ihren Kopf. Dieses Blut etwa, das sie letztens so deutlich in ihrem Mund geschmeckt hatte. Und dass sie Tier- oder sogar Menschenopfer dargebracht hatte. Das war zugleich völlig absurd und doch gab es in Marie eine unerschütterliche Gewissheit, dass all dies stimmte. Ob ihr diese Erinnerung Zugang zu dem verschaffen sollte, zu dem Menschen alles fähig sind, was sie tatsächlich tun konnten?
Marie hatte derart vertieft ihren Gedanken nachgehangen, dass sie gar nicht gemerkt hatte, dass sie mit hundertzehn auf der Überholspur entlangschlich, geradewegs genauso schnell wie der Kleinlaster, den sie eigentlich überholen wollte. Hinter ihr hatte sich schon eine nervös zuckend Autoschlange gebildet. Sie gab Gas, überholte zügig und scherte sofort vor dem Laster auf die rechte Spur ein.
Ja, ja, ist ja schon gut, murmelte Marie vor sich hin, als die Autoschlange sie überholte und sie ein genervt-böser Blick nach dem nächsten traf – jeder Wagen fuhr natürlich nun so langsam an ihr vorbei, dass er auch ausreichend Zeit hatte, ihr auf seine Weise seinen Unmut kund zu tun.
In ihrem Büro sortierte Marie erst einmal ihre Hamburger Notizen.
Also: Sokwe Soselo stammte aus einem Vorort von Mwanza, einem Provinzhauptstädtchen in Tansania, von wo auch der Vater und die Schwester des toten Jungen gekommen waren – alles Murundis. Sein bester Freund hieß Ismael Murundi. Er könnte eventuell der Bruder des Vaters des toten Albinojungen sein. Nicht ganz unwahrscheinlich sogar. Dann wäre ja übrigens Soselos ehemaliger bester Freund, der blutsverwandte Onkel des toten Jungen. Und dieses Mwanza direkt am Viktoriasee war wahrscheinlich aufgrund der wirtschaftlichen Armut und der daraufhin entflammten Verzweiflung der Bevölkerung eine der Hochburgen dieses Albino-Aberglaubens. Albino-Haare in Fischernetzen und weit mehr.
Mit Laima ist möglicherweise die inzwischen verstorbene Großmutter des Besten Freundes von Sokwe Soselo gemeint. Aber vielleicht wurde auch eine Enkelin nach dieser Großmutter benannt. Diese Großmutter stellt jedenfall eine – zumindest ehemals – enge Verbindung zwischen diesen Murundis und Sokwe Soselo her.
Und zu dem geheimnisvollen Zauberzettel, der mit Sicherheit dem toten Albinojungen mitgegeben wurde: Adinkra ist nicht nur in Ghana bekannt. Zumindest in den etwas besseren Kreisen in Tansania, zu denen auch die Soselos gehören, sind wenigstens einige der Schriftsymbole und ihre Zauberkraft bekannt. Auch Ismael Murundi waren die Adinkra Schriftsymbole vertraut.
Viele Details führten jetzt zueinander und rückten die Soselos erst einmal in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Doch Marie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, das dieser offen freundliche Mann irgendetwas mit dem Tod des kleinen Jungen zu tun haben sollte. Und auch Frau Soselo schien ihr bei aller auch vorhandenen Härte nicht in der Lage, einem Baby, noch dazu, wo es ein Albino war wie ihr eigener Sohn, auch nur ein Haar zu krümmen. Doch sie würde sich natürlich nicht von ihren persönlichen Eindrücken und Gefühlen beeinflussen lassen. Dazu war Marie Profi genug. Aber es verdichtete sich eben doch die Ermittlung auf die Soselos und ihr Umfeld.
Sie musste Imbakwe Murundi finden, der konnte sich mit seiner Tochter doch nicht in Luft auflösen. Für Deutschland war diese Kombination doch eher ungewöhnlich: ein schwarzer Vater mit einer sieben- oder achtjährigen dunkelhäutigen Tochter. Sie würde die beiden zur Fahndung rausgeben müssen, denn das würde die Chancen wesentlich erhöhen, die beiden ausfindig zu machen. Jede Polizeidienststelle würde dann nach den beiden Ausschau halten.
Marie füllte das Formular zur Fahndungsverfügung aus und schickte es mit einem Mausklick in den Äther – oder genauer gesagt über den Verteiler des Polizeicomputers an die zuständigen Dienststellen.
Dann kam Marie noch die Idee, es über den informellen Weg zu versuchen, eine Information direkt aus Tansania zu bekommen. Über den polizeiinternen internationalen Suchdienst fand sie die Adresse der obersten tansanischen Polizeidienststelle in Mwanza heraus. Es gab die Möglichkeit, über nur intern nutzbare elektronische Formulare – über den kurzen Dienstweg gewissermaßen – international, also tatsächlich über alle Grenzen hinweg, kleine Informationen auszutauschen. Das war ein Polizeiservice, dem sich zur Bekämpfung der immer internationaler operierenden organisierten Kriminalität viele Nationen angeschlossen hatten. Das ganze war jedoch tatsächlich nur informell und blieb in der absoluten Handlungsfreiheit der jeweiligen Nation beziehungsweise Behörde. Auf gut deutsch hieß das: Man musste schon gutes Glück mit dem Ansprechpartner haben, wenn man auf diesem Weg tatsächlich eine erfragte Information erhielt, denn es war niemand verpflichtet, dies zu tun und überhaupt zu antworten.
Marie entschied sich, diesen Weg einfach zu probieren. Sie hatte nichts zu verlieren. Entweder erhielt sie eine schnelle Email-Antwort oder sie musste sich doch über den langen Dienstweg mit Formularen und Schaltstellen den Weg über Vorgesetzte und andere Behörden bahnen. In die entsprechende Fragenspalte tippte Marie ihre Frage ein: Is there any relationship known between Ismael Murundi (born in Pisiansi / Mwanza in +/-1970) an the younger man called Imbakwe Murundi? Are they brothers? Mit einem innerlichen Daumendrücken klickte Marie das „send“-Symbol an
Anschließend schaltete Marie ihren PC aus, räumte nach kurz ihre Teetasse und die angesammelten Wassergläser vom Schreibtisch, um nun so schnell wie möglich den Dienst hinter sich zu lassen und nach Hause zu kommen.
Sie wünschte sich so sehr einen schönen Spätnachmittag und Abend mit ihrem Sohn. Sie hatte schon einige Tage lang keine ruhigen Stunden mehr mit Lukas gehabt. Entweder Martin oder andere Leute waren da – was grundsätzlich ja auch schön und gut war – aber sie wollte gerne näher mit ihm sein, nicht aus den Augen und ihrem Herzen verlieren, was den Jungen wirklich in seinem Inneren bewegte. Vielleicht hatte sie heute nochmals Glück und Lukas war nicht mit Freunden unterwegs oder sonstwie in ein Schiff oder Ähnliches vertieft und hatte vielleicht sogar Lust, mit ihr etwas zu unternehmen.