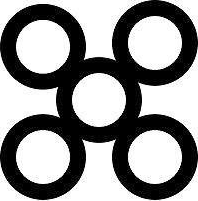
27
Lukas zog den langstieligen Löffel durch das dickwandige bunte Glas und dieser kam gefüllt mit quietschblauem Engeleis und schwarzen Schlieren dickflüssiger Schokoladensoße wieder zum Vorschein. Der Junge liebte diesen Engelbecher und schob sich hoch konzentriert Löffel für Löffel diese Köstlichkeit in den Mund.
„Wie war´s denn heute in der Schule?“
Manchmal musste Marie richtig überlegen, wie sie Kontakt zum Innersten dieses Jungen herstellen konnte, der so in sich selbst zu ruhen und sich meist selbst genug zu sein schien. Vielleicht öffnete ja diese Standard-Mütter-Frage eine Tür.
„Wir haben heute einen Film gesehen, über Schmetterlinge.“
Ein weiterer blau-schwarz gefüllter Löffel bahnte sich den Weg durch die dadurch zum Schweigen gebrachten Lippen.
„Wie aus so einem winzigen, klitztekleinen Ei…“ Lukas presste Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand zusammen, um seiner Mutter zu zeigen, wie winziglich bis unsichtbar ein solches Schmetterlingsei ist, „…eine Raupe und dann ein Schmetterling wird.“
„Das ist ja spannend!“
„Das ist jedes Mal ein anderes Tier. Die Raupe ist ganz anders als das Ei. Und dann wird die ganz steif und hart und hängt sich an einen Grashalm und dann fliegt der Schmetterling durch die Luft. Die Raupe kann gar nicht fliegen.“
Es folgte ein weiterer schwarz-blauer Löffel.
„Ja. Die verwandelt sich jedes Mal wie von Zauberhand. Als hätte da Harry Potter seinen Zauberstab im Spiel.“
„Nein, Mama!“ Lukas tropfte ein hellblauer Tropfen aus seinem rechten Mundwinkel. „Das hat doch nichts mit Harry Potter zu tun. Das hat Gott gemacht.“
Marie war verblüfft, mit welch wenigen klaren Worten und mit welcher Sicherheit ihr Sohn die Schöpfung beschrieb. Woher er das nur hatte? Sie selbst hatte so wenig Zugang zu Gott, auch wenn sich ihr in den letzten Jahren immer intensiver die größeren geistigen Zusammenhänge vor Augen, vor ihren Verstand geführt wurden. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, alle Vielfalt des Seins auf nur ein Einziges zurückzuführen, auf so eine Art Überfigur. Irgendwie reichte ihr Verstand für diese geistige Komprimierung nicht aus. Vielleicht hatte sie an der Stelle ja schlicht ein Vater-Problem. So ließ sie diese Frage nach dem Ursprung und letztem Zusammenhalt in ihrem Weltbild irgendwie offen. Und Marie beließ es bei dem Bild von einem Licht, etwas Gutem, etwas Positivem, von dem alles ausging, nicht nur bei der Erschaffung der Welt, sondern auch bis in die heutige Zeit hinein. Damit konnte sie meditieren, das hielt ihre kleine Welt bislang irgendwie zusammen – meistens jedenfalls.
Vielleicht hatte Lukas das Selbstverständnis um Gott von seiner Großmutter übernommen. Klara war zwar keine Kirchgängerin, also keine Gläubige im landläufig christlichen Sinne und hatte schon manch seltsamen Besuch des Dorfpfarrers über sich ergehen lassen müssen, der meinte, ein verlorenes Schaf zurück in die Herde holen zu müssen, doch in Maries Augen war ihre Mutter christlicher als die meisten Menschen, die sie kannte. Klara war stets bereit zu helfen, wenn sie irgendwie und irgendwo gebraucht wurde. Sie fackelte in großen, aber auch den kleinen Notsituationen auch nicht lange rum, sondern stellte sich meist gleich in den Dienst zu helfen. Marie fand, dass ihre Mutter etwas Dienendes hatte, ohne dabei auch nur den Anflug von Unterwürfigkeit durchblicken zu lassen. Es war eher so, als wäre das Helfen und für andere da sein ihr pragmatisches Lebensprogramm. Das war eben so: Es war etwas zu tun, also tat sie es. Das war einfach selbstverständlich – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie erwartete weder Lob noch Entlohnung dafür. Hervorgehoben zu werden war Klara nicht nur unangenehm, es war ihr fast zuwider.
Von dieser selbstverständlichen Art schien Lukas einiges abbekommen zu haben. Ohne nun extrem brav oder gar angepasst zu sein, war Lukas ein zufriedener Junge, der einfach das tat was anstand. Er war folgsam und zugleich auch ungewöhnlich eigenständig in seinem Tun. Lukas übernahm auch von sich aus Aufgaben, und nicht nur die, die ihm Spaß machten. Er war selten schlecht gelaunt und lief rund, wie Marie gerne anderen gegenüber bemerkte, vor allem anderen Müttern gegenüber.
Dieser Kelch der inneren Ruhe, Gelassenheit und in gewissem Maß konzentrierten Bescheidenheit war wohl irgendwie an ihr selbst vorübergegangen. Marie fühlte sich nicht unwohl in ihrer Haut, beileibe nicht. Aber diese Ruhe, dieses auf tiefem Vertrauen gegründete innere Selbstverständnis war ihr nicht so einfach gegeben. Marie hatte das Gefühl, dass sie dafür stets etwas tun musste.
Vielleicht waren die anderen aber auch schlicht in ihrem Glauben gehalten. Bei ihrer Mutter sah sie den Zusammenhang deutlich. Klara hatte ein tiefes Vertrauen in Gott, in einen Schöpfer und Weltenlenker, auch wenn sie die „Wege des Herrn“ nicht immer verstand. Klara verbrauchte kaum Kraft, Zeit und Energie mit Hadern und Zweifeln. Klara hatte sich ihre Lebensaufgabe gesucht, oder diese vielleicht auch nur gefunden – und sie erfüllte sie so gut sie vermochte. Marie hingegegen musste immer wieder alles neu durchsortieren, was ihr das Leben so lieferte, Sinnzusammenhänge erstellen und manchmal auch konstruieren etwa, um ihren Verstand zur Ruhe zu bringen. Aber ihr Wesenskern war noch nicht angekommen, war noch nicht in seiner Mitte angelangt und gesettelt.
Und dieser wunderbare achtjährige Junge, der ihr gegenüber in Tonis Eisdiele saß, der mit dem allmählich dahinschmelzenden Engelblau und seiner Schokoladensoße inzwischen großräumig um seinen Mund herum kämpfte und den sie über alles liebte, dieser Bursche hatte seine Mitte schon gefunden. Oder gleich mitgebracht auf die Welt – manchmal kam es Marie eher so vor. Schon als Baby ruhte Lukas in sich und strahlte mit dem zufriedendsten Babygesicht, das Marie jemals gesehen hatte, in die Welt. Klara sagte ihr immer, wenn Marie staunend, manchmal sogar etwas fassungslos vor ihren Sonnenschein von Sohn stand: „Lukas ist ein Sternenkind, und das ist vom Himmel in deinen Schoß gefallen. Freu dich einfach an ihm.“
Und jetzt freute sie sich am dem hellblau mit schwarzen Schlieren verschmierten Kindermund vor sich, aus dem gerade eine glückliches „Geschafft!“ zu ihr herüberwehte. Marie war versucht, ihre Serviette, mit der sie die ganze Zeit herumgespielt hatte als sie ihren Gedanken nachhing, zu falten, um sie in Richtung des bunten Schmiermundes zu bringen. Gott sei dank hatte sie sich beherrscht, denn im nächsten Moment fuhr Lukas eigene Serviette durch das Schmelzeismuster. Lukas hatte es noch nie leiden können, den Mund abgewischt zu bekommen. Schon als Einjähriger hatte er bei der Annährung einer stoff- oder papierbewaffneten Hand die Lippen aufeinander gepresst und seinen Kopf wo weit wie möglich weggedreht. Unzählige Male hatte sich Marie über Lukas Unwillen hinwegsetzen müssen – zumindest glaubte sie, dies tun zu müssen. Hätte sie einen Nutella-verschmierten Jungen in den Kindergarten schicken können? Oder hätte sie den Winzling den Möhrenbrei in seinem Gesicht in seinem gesamten Kinderwagen verteilen lassen sollen? So sah sich Marie immer wieder genötigt, die Grenzen bei ihrem Sohn zu überschreiten. Obwohl sie sich während ihrer Schwangerschaft so fest vorgenommen hatte, das niemals zu tun. Aber der Junge verübelte ihr diese Grenzüberschreitungen nicht. War das Gewische erledigt, strahlte sie der Bursche sofort wieder an. Lukas war wirklich ein Geschenk des Himmels, unerklärbar für sie von dort vor ihre Füße gefallen. Er brachte einfach nur Glück und Licht in ihr Leben.
Willi knusperte die Eiswaffel auf, die er obligatorisch bei Tonis erhielt. Der Hovawart bettelte nicht, wusste aber genau, was ihm laut eingeübter Rituale zustand und schaute seine Menschen mit entsprechend intensivem Blick an. Bei Eisvehrzehr stand dem Hund einfach ein Stück Waffel zu. Und er bekam es auch.
Die drei Johannssons hatten eine vergnüglichen Spaziergang hinter sich, mit „Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst“, Stöckchenwerfen, Spielplatzklettern und was sonst noch Jungen- und Hundeherzen bewegt. Die Eisdiele heute war der Höhepunkt.
Gemütlich schlenderten die drei zurück zu ihrem Haus, wo Klara bereits mit dem Abendessen auf sie wartete.
Willi erhielt seine Trockengnörzel an Hundewurst, einer für ihn höchst delikaten Blutwurst mit allerlei Innereien frisch vom Metzger im Ort. Die übrigen drei Johannssons machten sich über knusprige Reibekuchen mit selbstgemachtem Apfelmus her. Klara machte natürlich die besten Reibekuchen der Welt – da waren sich die beiden Jüngeren sicher und lobten Klara über den grünen Klee.
„Martin hat für dich angerufen. Dein Telefon lag in der Küche und ich bin aus Versehen drangegangen. Ich hoffe das ist nicht schlimm für dich.“
„Nein, ist schon ok.“
Marie war so guter Laune und freute sich schon allein über den in den Raum ausgesprochenen Namen ihres geliebten Freundes.
„Ich werde ihn gleich zurückrufen.“
Lukas war fertig mit seinem Abendbrot und zog sich auf sein Zimmer zurück.
„Darf ich dir das Abräumen auch noch überlassen?“ fragte Marie ihre Mutter mit einem kleinen Zwinkern in ihren Augen.
„Sicher. Ruf mal schnell an!“
Klara hatte bereits die fettglänzenden Teller zusammengestellt.
Marie nahm ihr Telefon und zog sich in die etwas abseits gelegene kleine gemütliche Sitzecke ihres Gartens zurück.
„Schmidtbauer.“
„Hallo Martin. Ich bin´s.“
„Marie!“ Martins Atem entließ einen kleinen Seufzer.
„Geht es dir gut, mein Lieber?“
„Ja, sehr gut. Und noch besser, wenn ich dich in meinen Armen halten könnte.“
„Willst du nicht einfach noch vorbeikommen?“
„Jetzt noch? Es ist schon Viertel nach Acht?“
„Na und. Die Nacht ist noch lang. Ich sehne mich auch nach dir. Ich fände es wunderbar, neben dir einzuschlafen.“
„Ok. Ich muss aber morgen früh raus. Richtig früh. Von dir aus muss ich um halb sechs losfahren. Ich habe nämlich morgen einen Dreh in Hamburg.“
„Oh, das ist schön, mein kleiner großer James Bond.“
„Nein, kein großer Spielfilm. Ich habe eine Rolle in einer Feierabendserie bekommen. Den bösen Liebhaber mal wieder, der die Herzen der stolzesten Frauen bricht und triumphierend weiterzieht.“
„Das kannst du wohl. Aber du bist viel zu gut, das zu tun. Ist schon seltsam, dass du immer wieder solche Rollen bekommst.“
„Na ja, meine rothaarige und grünäugige Größe taugen wohl nicht für das Klischee des liebevollen Gefährten.“
„Na, dann komm schnell her, mein liebevoller grünäugiger Gefährte. Hier hast du die Hauptrolle. Und ich freue mich auf dich. Möchtest du noch Reibekuchen, du weißt, die guten von Klara?“
„Gerne, wenn ihr mir noch was übriglassen könnt?“
Eine Dreiviertelstunde später traf Martin ein, von allen drei Johannssons teils liebevoll, teils stürmisch begrüßt. Als Klara ihm die übriggebliebenen Reibekuchen erwärmte musste er Lukas zum vierten Mal die Begegnung mit James Bond erzählen und wie die bombastischen Stunts gemacht wurden. Dabei drückte sich der Junge ganz eng zwischen Martin und Marie, fast so, als wolle er die Herzen dieser beiden Menschen, die er so sehr liebte, auf immer miteinander verbinden.
Klara verabschiedete sich bald darauf mit einem leuchtenden „Ich muß noch telefonieren“. Marie und Martin sahen sich nur kurz an und teilten in dem Blick ihre Freude über Klaras Glück.
Lukas erzählte Martin noch von seinem Tag, dass er und sein bester Freund Tom heute beschlossen hätten, ein richtiges Schiff zu bauen, eines, das man richtig ins Wasser setzen kann. Solche Vorhaben unter Jungs erfuhr Marie nur sehr selten direkt von ihrem Sohn. Da schien tatsächlich so etwas wie eine Männerrunde, männliche Energie oder wie immer sie das nennen wollte notwendig zu sein. Und so vertieften sich die beiden Männer auch in eine Art Fachgespräch über Bootsbau – auch wenn Martin darin wahrlich nicht bewandert war und Marie sich meist als technisch weitaus geschickter erlebte. Aber das zählte nun überhaupt nicht und Marie hielt sich auch zurück. Sie lehnte sich schweigend an Martins Schulter und bot ihrem Sohn ihre Brust an, an die er sich auch genüsslich anlehnte. Marie sank in sanften Vorschlaf, in den das Gemurmel ihrer Männer tropfte, ohne dass sich auch nur eines der gesprochenen Worte in ihren Ohren ausformulierte. Marie genoss den unaufgelösten Redesingsang und ließ sich einfach in ihr Glück fallen.
Bald ging Lukas von sich aus ins Bett. Er war sichtlich zufrieden mit dem Tag und wohlig müde wie seine Mutter. Marie kuschelte sich im Bett an Martin an – so eng es die Tatsache zweier getrennter Körper zuließ – und fiel noch unter seinen zärtlichen Gutenachtküssen in tiefen Schlaf. Martin beobachtete noch eine Weile das weich entspannte Gesicht seiner Geliebten und das Auf und Ab ihrer atmenden Brust, ehe auch er in wohltuenden Schlaf hinüberglitt.
28
Marie wurde diesen Morgen von einem ungewöhnlich ungeduldig klingelnden Diensttelefon regelrecht aus ihrer Jacke gerissen, die sie noch eben über die Lehne des Gaststuhls in ihrem Büro werfen konnte, ehe sie den Hörer abnehmen konnte.
„Johannsson.“ Maries Stimme war leise und atemlos.
„Robert hier, Marie, guten Morgen. Ich habe dich doch nicht etwa aus dem Dienstschlaf geholt?“
„Nein, Robert, aber aus meiner Jacke katapultiert. Ich bin gerade reingekommen. Kann es sein, dass du eine wichtige Information hast? Das Klingeln klang nämlich so ungemein ungeduldig?“ Marie grinste vor sich hin ob ihrer guten Laune.
„Aha, schöne Frau. Die Melancholie der Liebe ist nun endgültig von dir gewichen. Du bist wieder an Bord. Schön. Schön. Und: Ja. Ich habe was Neues.“
„Na, dann schieß mal los, Kollege! Ich bin gespannt!“
„Ich war gestern nachmittag noch Mal bei den Soselos,“ begann Robert Leicht nun in ernstem Tonfall. „Ich brauchte unter anderem noch Unterschriften unter einige Aussageprotokolle und wollte noch einige Details abklären. Das nette Kindermädchen hat mich wieder reingelassen und ich habe wieder auf die geschäftige Frau Soselo gewartet. Du erinnerst dich doch noch an die Bildergalerie auf dem Sideboard im Eingangsbereich?“
„Ja, recht genau. Da standen ja einige interessante Fotos.“
„Genau, standen. Eins hat gestern nämlich gefehlt.“
„Aha,“ kommentierte Marie erwartungsvoll. Und ehe Robert Luft holen und zum Weiterreden ansetzen konnte, fuhr Marie fort: „Darf ich raten: Der einzelne Mann, der Schwarzafrikaner, der etwas kräftiger war als die anderen der Sippe?“
„Marie…!“ rief ihr Kollege gespielt entrüstet durch das Telefon. „Ist das jetzt weibliche Intuition, hellseherische Fähigkeit oder einfach professionelle Beabachtungsgabe? Ja, du hast recht. Der bullige Schwarze stand da nicht mehr. Da in dem Moment Frau Soselo hereinkam, konzentrierte ich mich auf das älteste Bild, das wohl kurz nach der Erfindung der Fotografie aufgenommen sein muss.“
„Sehr gut, Robert. Das heißt, Frau Soselo hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass dir das Verschwinden des Fotos aufgefallen ist?“
„Ja, ich glaube nicht. Also, ich bin mir ziehmlich sicher. Denn sie ist ungewohnt redselig auf das alte Foto eingegangen und hat mir, ohne dass ich sie gefragt hätte, von dem Mann auf dem Bild erzählt. Das war für meinen Geschmack ein deutliches Ablenkungsmanöver. Aber auch informativ.“
„Der Häuptling oder wie man sagt…?“ dachte Marie mit.
„Ja. Das ist ein ganz berühmter Stammesfürst aus einer alten und sehr hoch stehenden Linie. Ihr Ur-Ur-Ur-Großvater oder so ähnlich. Wieviel Urs weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall stammt Frau Soselo aus einer alten schwarzafrikanischen Adelslinie. So was Blaublütiges hat sie ja bis heute bewahrt. So eine gewisse innere Haltung, die sich nicht so schnell was vom Brot nehmen lässt. Und nun halt dich fest, wo sie herstammt, diese Familienlinie?“
„Aus Tansania? Nein, das wäre zu einfach. Nein – aus Ghana?“
„Jawohl! Ist doch ein Ding, wie das auf einmal alles zusammen passt, findest du nicht auch?“
„Ja, das ist schon spannend,“ antwortete Marie. „Und Stammesfürsten und Könige – waren das nicht früher vor allem Albinos? Das habe ich doch im Zusammenhang mit der Albino-Recherche irgendwo gelesen. Oder der Doc hat mir das erzählt. Da wird wohl auch die genetische Wurzel für Jumo liegen. Das heißt auch, ihre Ursprungsfamilie wird sich immer wieder mal auch mit Albinos und dem ganzen Drumherum auseinandergesetzt haben. Wobei – dieser Aberglaube mit dem Albino-Fetisch ist ja noch sehr jung. Oder zumindest erst vor kurzem wieder erwacht. Ob die Albinos früher in Afrika immer nur höchste Wertschätzung erfahren haben, weiß ich natürlich nicht. Ist im Moment vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall bestätigt das unsere Vermutung, dass die Soselos – direkt oder indirekt – etwas mit der ganzen Sache zu tun haben.“
„Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so,“ gab Robert zurück und dachte gleich laut weiter: „Und wie kommen wir jetzt am geschicktesten an den bulligen Schwarzen ran?“
„Da fällt uns noch was ein. Jedenfalls haben wir ihn in der Hinterhand den Soselos gegenüber. Warte mal – hatte Soselo nicht gesagt, dass ein Onkel nicht nur ein Blutsverwandter, sondern auch ein Gönner, ein Sponsor, ein Mäzen ist? Kannst du dich noch erinnern?“
„Nein, das muss wohl gefallen sein, als du alleine mit ihm gesprochen hast. Aber das wäre eine höchst interessante Alternative zu unserem Vaterbruder.“
„Sah der Typ auf dem Foto nicht auch ziehmlich wohlhabend aus? Ich meine – ich weiß nicht… Ich kann mich nicht mehr so genau an irgendwelche Einzelheiten erinnern.“
Robert dachte kurz nach: „Ja, das stimmt. Wo du das jetzt sagst. Ich meine, der hätte sogar einen dicken Siegelring am kleinen Finger gehabt. Erst einmal ungewöhnlich für einen Schwarzafrikaner. Oder für uns an einem Schwarzafrikaner. Uih, beim Thema Afrika sind die Fettnäpfchen aber auch immer links und rechts sehr eng gesetzt.“
„Robert, mir kommt da so eine Idee. Ich versuch das mal telefonisch zu klären. Ich rufe dich gleich wieder an.“ Und schon hatte Marie aufgelegt. Den verdutzt über den nun gleichmäßig tutenden Hörer blickenden Robert am anderen Ende der Leitung konnte sie natürlich nicht sehen.
Marie kramte ihre auf gut fünf Zentimeter Höhe angefüllte linke Schreibtischseite durch. Alles Dinge, Zettel und Unterlagen, die zur Zeit natürlich enorm wichtig waren und daher in Reichweite am besten aufgehoben. Nach kurzer Zeit geübten Stocherns fischte sie ihr Alleswisserbuch hervor und zog zielsicher aus einem Seitenfach eine Visitenkarte. Rasch tippte sie die abgelesene Nummer ein und räusperte sich einmal laut.
„Mühling, Sekreteriat Soselo, Botanisches Institut in Hamburg, guten Morgen!“ Die stets freundliche Stimme von Soselos Sekretärin klang gewohnt professionell.
„Johannsson, Kriminalpolizei Rendsburg. Guten Morgen. Ich hätte gerne in einer dringenden Angelegenheit Professor Soselo gesprochen.“
„Einen Moment bitte, ich stelle durch.“
Professionalität schien Professionalität schneller die Türen zu öffnen.
„Soselo!“ meldete sich die ruhige Stimme.
„Guten Morgen, Herr Soselo. Hier ist Johannsson, Kripo Rendsburg noch mal.“
„Ach, guten Morgen, Frau Johannsson. Sie werden ja richtig anhänglich.“
Marie überging die kleine, aber im freundlichen Tonfall verabreichte Spitze – seine Frau schien doch schon mehr als bislang bemerkt auf ihn abgefärbt zu haben. „Ich sitze gerade bei meinen Protokollen, Herr Soselo, und nun fehlen mir noch ein paar Einzelheiten, damit ich das abschließen kann. Haben Sie gerade ein paar Minuten Zeit?“
„Wenn es kurz geht, ja. In zehn Minuten muss ich schon wieder weg.“
Aha, heute war der Herr nicht in altbekannter Bestlaune inklusive Gelassenheit. War vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er etwas dünnhäutiger war heute. Dann ließ er sich vielleicht besser hervorlocken.
„Es geht um Ihre Daten. Wann sind Sie nochmal aus Pisiansi weggegangen?“
„Wofür brauchen Sie das denn?“
Eine kurze Pause. Beide schwiegen an ihren Hörern.
„Na egal. Ich muss mal kurz nachdenken. Das muss 1984 oder 85 gewesen sein. Ich war etwa 14 oder 15 Jahre alt. Kojo habe ich mit 12 Jahren kennengelernt. Ja, und kurz darauf bin ich dann auf die Highschool.“
Ohne Nachzudenken fragte Marie spontan nach: „In Ghana?“
„Ja, auf der International Highschool in Ghana. Aber nur sehr kurz, nur einige Monate. Dann gings gleich auf eine deutschsprachige Schule in Südafrika und kurz darauf schon nach Deutschland.“
Kurze Pause.
„Aber wieso interessiert Sie denn mein Bildungsweg. Bin ich irgendeiner Tat dringend verdächtig?“
„Nein, Herr Soselo. Überhaupt nicht. Aber, wer ist Herr Kojo?“
„Onkel Kojo hat viel Gutes für mich getan. Er hat mich unterstützt und mir meine berufliche Laufbahn ermöglicht. Wie kommen Sie auf ihn?“
„Sie haben ihn eben selbst erwähnt. Ist Kojo der Herr auf einem Ihrer Fotos in der Familiengalerie?“
Sokwe Soselo wurde stutzig: „Was wollen Sie von mir? Sie quetschen mich ja regelrecht aus. Samuel Kojo ist, oder vielmehr war, mein Mäzen. Ein guter Mann, der mich aus meinen einfachen Verhältnissen herausgeholt hat. Doch weshalb interessiert Sie das. Ich denke, Sie vervollständigen Ihre Akten. Und es geht doch um ein totes Albino-Baby. Ich habe damit nun wahrhaftig nichts zu tun. Ich muss auch jetzt los. Wenn Sie noch mehr wissen müssen, dann lassen Sie sich bitte von meiner Sekretärin einen Termin geben, Frau Johannsson. Auf Wiederhören!“
Ungehalten legte Herr Soselo auf.
Marie war zufrieden. Hatte Sie doch den richtigen Riecher gehabt. Rasch notierte sie den Namen von Soselos Gönner: Samuel Kojo. Sie war sich mit einem Mal sicher, dass das der bullige Mann auf dem verschwundenen Foto war.
Marie wählte die Hamburger Dienstnummer: „Robert, es hat geklappt. Also: Sokwe Soselo ist mit etwa 15 jahren auf eine anerkannte Highschool in Ghana gegangen. Und das konnte er, weil er einen Gönner hatte – Samuel Kojo. Und ich fress einen Besen, wenn das nicht unser verschwundener bulliger Schwarzafrikaner ist.“
Robert war verblüfft: „Wie hast du das denn so schnell herausgekriegt, Marie? Du hörst mich staunen!“
„Tja, ich hatte so eine Idee, und es hat funktioniert. Ich habe einfach Soselo angerufen und in Banalitäten ein paar banale Fragen eingestreut. Er war zwar zunächst verdutzt, dann auch schnell angenervt – aber er hat dennoch das meiste beantwortet. Deswegen – ich glaube trotz all unserer Fakten nicht, dass Soselo selbst etwas mit der Geschichte zu tun hat. Ich müsste mich schon sehr irren. Ich glaube, der Mann ist eine ganz ehrliche Haut. Und seine Frau auch nicht. Aber die beiden sind die Verbindungsglieder, das wird doch immer deutlicher. Zum einen zwischen Tansania, nun auch Ghana, und zu Deutschland sowieso. Und zum anderen zwischen den Murundis – wenn wir davon ausgehen, dass Imbakwe Murundi der Vater des toten Kleinen ist und Laima seine ältere Schwester, benannt nach der Großmutter. Der Großmutter, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Wahl-Großmutter unseres Soselos war und deshalb auch die Großmutter seines besten Kindheits- und Jugendfreundes Ismael Murundi. Der wiederum wäre der Onkel des toten Babys. Und nun ist noch ein anderer Onkel, der Gönner-Onkel des jungen Sokwe Soselo dazugekommen.“
Marie machte eine kurze Gedanken- und Atempause.
Robert meinte nur kurz: „Das ganze lichtet sich anscheinend…“
„Ja, wir müssen jetzt nur noch Imbakwe Murundi finden. Ich glaube, der weiß ganz genau, was mit seinem Sohn passiert ist. Wobei ich nicht glaube, dass der Vater seinem Spross was angetan hat. Wozu hätte er dazu nach Deutschland fahren sollen?“
„Das sehe ich auch so,“ ergänzte Robert. „Diese Überfahrt mit den beiden Kindern nach Deutschland sieht mir auch eher wie eine dramatische Rettungsaktion aus – die aber leider nicht geglückt ist. Unklar bleibt doch im Wesentlichen die Rolle der beiden Onkel – des vermutlich leiblichen und des bulligen Gönner-Onkels“.
Wie auf Bestellung klingelte Maries Computer. Auf dem Bildschirm tauchte die Mitteilung auf: Sie haben eine neue Nachricht erhalten.
„Heute ist schon wieder mein Glückstag, Robert. Warte einen Moment. Kann sein, dass ich eine klärende Mail erhalten habe.“
„Ok. Marie, ich bleib dran.“
„Ja!“ fiel es mit einem erleichterten Seufzer aus Marie heraus.
„Robert, der informelle Dienstweg hat das erste Mal funktioniert. Ich habe eine Antwort aus Tansania: Ismael Murundi, born in 1971, and Imbakwe Murundi, born in 1986, both in Mwanza, are related as brothers. No criminal entry. Also es sind zwei Brüder. Und beide haben, zumindest in Afrika, bislang eine saubere Weste. Ich werde es auf dem selben Wege nochmal mit unserem Geld-Onkel Samuel Kojo probieren.“
„Meinst du, ich sollte es noch einmal bei Frau Soselo probieren? Wenn Samuel Kojo der Jugendmäzen ihres Mannes war und der Mann sogar einen Ehrenplatz in der Familiengalerie hatte – wenn er es denn war -, dann wird sie ganz sicher auch etwas über ihn wissen. Was meinst du?“ fragte Robert, selbst noch wenig von seinen Worten überzeugt.
„Ich weiß nicht, ob wir die gewiefte Frau auf direktem Weg knacken können. Bislang hat sie noch nichts erzählt oder herausrutschen lassen, was sie nicht wollte. Frau Soselo ist nicht nur höchst intelligent, sondern auch sehr kontrolliert. Die Gefahr ist halt, dass wir den Soselos unsere Spur verraten. Bislang haben wir den Kojo quasi noch in der Hinterhand. Ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal ohne die Soselos recherchieren. Vielleicht kann Gabi auch mit ihren Afrika-Kontakten was erreichen. Vielleicht ist Samuel Kojo nicht nur reich, sondern sehr reich. Vielleicht ist er in Tansania sogar ein bekannter Mann. Lass uns erst auf dem klassischen Polizeiweg arbeiten. Das kommt mir im Moment, ehrlich gesagt, erfolgversprechender vor.“
Robert stimmte seiner Rendsburger Kollegin sofort zu und versprach, sich um Kojo zu kümmern. Die beiden verabschiedeten sich herzlich voneinander.
Marie tippte zunächste den nächsten informellen Mail-Text nach Tanasania ein: Do You have any information about a man called Samuel Kojo, who had contact to Mwanza, Ghana and South Africa? He seemed to be a successful businessman. And great thanks for the further information about the Murundi brothers. You gave us a very great help. Thank you very much and yours sincerely – Marie Jahannsson, police chief inspector, Rendsburg, Germany.
Marie war nur froh, dass für Afrikaner Englisch auch eine Fremdsprache war und wahrscheinlich ein solches Hilfmittel wie für sie auch. Denn sonst hätte sie sich niemals getraut, in dem Schreiben so zu radebrechen.
Dann probierte sie ihre nächste Idee einfach aus. Marie rief Google auf und gab in das Suchfeld „Samuel Kojo“ ein. Dann klickte sie zunächst auf den Suchmodus „Seiten auf Deutsch“. Nach einigen Sekunden erschien die Antwort: Lauter Links zu Dr. med. Samuel Kojo Darkoh, Praktischer Arzt, Dortmund. Marie notierte sich zwar Namen und Anschrift des Arztes, aber es erschien ihr mehr als unwahrscheinlich, dass es sich bei dem in Deutschland lebenden und praktizierenden Arzt um „ihren“ Samuel Kojo handelte. Zumal scheinbar Kojo sein zweiter Vorname war. Deutschsprachig war dies alles, was Google hergab. Also weltweit. Sie klickte „das Web“ an. Die Zahl der Einträge schwoll netzgemäß rapide an: mehr als 3.000. Auf der ersten Trefferseite tauchte ein Pastor Samuel Kojo auf: Der Text begann: Faith Orphan Home, 45 Nkurumah Way, Kumasi Ghana. I’m the Director of Faith Orphan Home charity and humanitarian foundation…
Immerhin Ghana. Ein Pastor, der Spenden für seine humanitäre Einrichtung eintreiben will.
Der nächste Eintrag war Samuel Kojo DAPAAH, Director, Policy Planning, Monitoring and Evaluation Department, Ministry of Food and Agriculture, Accra. Kojo schien auf jeden Fall schon einmal ein nicht sehr seltener Vorname zu sein. Accra, war das ein Ort, eine afrikanische Stadt? Das wollte Marie noch schnell klären und ließ Wikipedia für sich arbeiten. Accra: Hauptstadt Ghanas, 2 Millionen Einwohner. Aha – die Verbindung dieses Namens nach Ghana war jedenfalls schon mal gegeben. Wenn auch Kojo eher ein gebräuchlicher ghanischer Vorname war. Aber es gab ihn ja auch als Nachnamen.
Marie klickte zurück auf die Google-Suchseite. Sie klickte die nächsten Trefferseiten an.
Neben diversen Eintragungen mit Kojo als weiterem Vornamen tauchte bald eine Latte an Links in einer Marie völlig fremden Sprache auf. Könnte eine afrikanische Sprache sein. Es war sogar was Japanisches dabei, wenn sie das richtig deutete. Marie hatte jedenfalls keine Chance, auch nur ein Wort über diesen oder die verschiedenen Samuel Kojo zu verstehen. Schade. Aber es gab etwas. Gabi hatte bestimmt mehr Glück. Die würde sicherlich auch als erstes googeln, aber mehr verstehen.
Marie versuchte es dann mit den Google-Bildern zu Samuel Kojo. Mehr als hundert Bilder-Links tauchten auf. Vielleicht erkannte sie ja ihren bulligen Schwarzafrikaner hier auf einem der Bilder wieder. Könnte ja sein. Bislang hatte sie bei ihrer Arbeit ja auch viel Glück gehabt. Marie klickte sich durch die Bilderflut durch. Es war schon erstaunlich, wer sich hier alles in den digitalen Äther stellte, von brusthaarfreien Muskel-Gays bis zu irgendwelchen Baby- und Familienfotos am Strand. Eine zusammenhangslose Informationsflut, die ohne Wahrung von Intimität durch das unglaubliche Informationsnetz schwirrte, das inzwischen die Erde umgab.
Marie ließ ihre Idee los und gab diesen Job mental an ihre Hamburger Kollegin weiter. Sie war auf einmal zuversichtlich, dass Gabi den Schleier von diesem ominösen Kojo lüften würde.
Sollte sie Gabi noch anrufen, um ihr die Dringlichkeit und die Hoffnung, die sie in sie setzte, mitzuteilen?
Nein. Das war nicht nötig, dachte Marie. Das würde Robert schon getan haben. Marie ließ nun endgültig den Kojo los . Es machte sich langsam eine Leere in ihrem Bauch breit. Doch ehe Marie zu Mittag essen wollte, schaute sie gerne noch bei Otto Storm vorbei. Sie wollte ihm die neuesten Ermittlungsergebnisse mitteilen. Vielleicht hatte ihr CSI-Mann noch eine zündende Idee zu dem aktuellen Stand.
Auf dem Weg in die kriminalen Katakomben der Rendsburger Mini-KTU schaute Marie bei Carena Mochita vorbei. Sie hatte ihre Sekretärin gefühlte Wochen nicht mehr gesehen.
„Buenos dias, Chefin,“ strahlte Mochita Marie an. Sie nahm Marie gleich intensiv mit ihrem großen Blick von unten in Augenschein.
„Moin, moin, Mochita,“ strahlte Marie zurück.
Alle Knoten, die sich in der letzten Zeit wie Fesseln um ihre Seele gelegt hatten, schienen sich aufgelöst zu haben. Marie war nicht nur sehr erleichtert, sie war auch glücklich. Richtig voll und ganz und rundherum glücklich. Und daran wollte sie auch ihre Mochita teilhaben lassen. Marie wusste, dass Mochita ihre Veränderung sofort wahrnehmen würde und freute sich schon darüber, wie sehr sich ihre Sekretärin über ihr Glück freuen würde.
„Aaah,“ seufzte Mochita mit ehrlicher Erleichterung. „Sie haben Ihr Herz wieder geöffnet. Die Liebe ist in Ihr Leben zurückgekehrt.“
Marie grinste Mochita in deren schwarz-leuchtende Augen: „Ja! Ja! Ja! Drei Mal Ja! Wir haben uns versöhnt. Und dieser Mann ist so wunderbar…“
Marie wiegte sich verliebt wie ein Schulmädchen hin und her.
Mochito strahlte ihr mit ihrem offenen Gesicht entgegen. Sie konnte sich so herrlich mitfreuen, ihre Carena Mochita. Diese herzensgute Frau war ebenfalls ein Geschenk des Himmels. In einem aufwallenden Überschwang trat Marie hinter Mochitas Schreibtischdrehstuhl und knüddelte und herzte die kleine rundliche Mexikanerin von ihren herabgebeugten Einsachtzig aus. Zum Schluss gab sie ihr einen dicken Kuss auf den Kopf.
„Chica, chica – chicita!“ brachte Mochita hervor, die nach der Bedrückung wieder richtig nach Luft schnappen musste. „Madre mia! Das Leben hat Sie voll wieder. Chica, ich freue mich so für Sie, Chefin.“
Wie häufig gingen Mochita die Dienst- und Vertrautheitsebenen durcheinander. Schon allein dafür hatte Marie die kleine Mexikanerin in ihr Herz geschlossen.
„Und der Fall geht auch voran. Mochita!“ setzte Marie ihre Glücksbotschaften fort. „Wir kennen jetzt Vater, Schwester und Onkel des kleinen Toten. Und die ganzen Zusammenhänge nehmen langsam Konturen an.“
Die Worte brachten beide Frauen wieder auf die Sachebene zurück. Die vier Augen im Raum leuchteten zwar weiter, aber aus den Gesichtern war das breite Strahlen einer nachdenklichen Klarheit gewichen.
„Und da hab ich auch was für Sie.“
Mochita zückte Stift und Papier.
„Versuchen Sie doch bitte alles über einen Samuel Kojo herauszubekommen. Samuel ist natürlich der Vorname, und Kojo der Nachname. Sehr viel häufiger ist beides speziell in Ghana nebeneinander Vorname. Aber unser Mann trägt Kojo als Nachnamen.“
Marie buchstabierte den Namen sicherheitshalber durch: „K – o – j – o. Und das volle Programm: Melderegister bis Interpol, Schulen, vor allem in Tansania und Ghana, wo er gelebt hat, und was Ihnen sonst noch einfällt. Interessant wäre auch, ob es irgendeine Verbindung zu unseren Hamburger Soselos gibt, oder zur Familie des Opfers, die heißen Murundi. Vater Imbakwe und Onkel Ismael.“
Marie ging zu Mochitas Schreibtisch und notierte ihrer Sekretärin die korrekte Schreibeweise der afrikanischen Namen.
Und mit einem aus den Hüften heraus tänzelnden – so weit es ihre Größe und Statur zuließen – „Ja, Mochita, das Leben ist wunderbar!“ wedelte Marie mit saloppem Finger-über-die-Schulter-Winken aus der Tür heraus.
Auf den Stufen des nüchternen Treppenhauses in den Keller des Polizeigebäudes ging Marie durch den Kopf, wie sehr doch die innere Einstellung die Gedanken und Sinne färbten. So als wäre mit der Versöhnung mit Martin in ihr ein Schalter umgelegt, so nahm sie nicht nur die Welt durch eine rosarote Brille war, nein, auch ihr Verstand schien wieder in Fluss geraten zu sein. Sie fühlte sich klar und ihre Gedanken strömten wieder sehr viel sortierter in ihrem Kopf. Sie hatte Einfälle und konnte auch wieder mit größerer Leichtigkeit Verknüpfungen herstellen. Die Liebe – und damit meinte Marie nun beileibe nicht den Sex, auch wenn sie darin nie eine Kostverächterin war – war wirklich das Lebenselexier schlechthin. Liebe öffnete alles, nicht nur das eigene Herz, die eigenen Sinne, den eigenen Verstand. Auch die anderen Menschen ließen sich gerne von diesem Virus infizieren. Diese Herzöffnung zog eine wahre Kettenreaktion nach sich. Die innere Flamme trug das Leuchten in die Welt hinaus und zündete weitere an.
Nun war Marie gespannt, ob sich ihre Stimmung auch auf den etwas spröderen Otto Storm auswirken würde, ob er sich auch anstecken ließe. Diesbezüglich haftete ja den Norddeutschen, zumal den Dithmarschern und denen, die´s noch weiter in den Nordwind gezogen hatte, das Vorurteil einer Art Infektionsresistenz an.
„Moin, Otto. Sind Sie da?“ rief Marie in den neonkalt beleuchteten Kellerraum.
„Jow!“ brummte es aus einem hinteren Winkel. „ Wer ist da? Marie, meen Deern?“
„Jow!“ gab Marie zurück.
Der schmale Einsneunziger schlurfte zügig – eine Bewegegungsabfolge, wie es nur ein Nordlicht kann – auf Marie zu: „Moin, moin, Marie.“ Und freundlich fragte er: „Was gibt’s meen Deern?“
„Ich wollte Ihnen das Neueste vom Fall um die grünen Bananen mitteilen. Ich dachte, das interessiert Sie. Und Sie wissen ja, wie ich Ihre Kombinationsgabe und Einfälle schätze. Vielleicht haben Sie noch eine weiterführende Idee.“
„Denn ma tou…“ Otto Storm ließ sich zumindest nicht erkennbar schmeicheln und schien bislang auch tatsächlich liebesstrahlungsresistent zu sein.
Marie wiederholte noch einmal etwas ausführlicher als soeben bei Mochita ihre neuesten Erkenntnisse zum toten Baby.
Otto Storm hörte schweigend zu. Marie sah jedoch deutlich die Aktivität in seinem Denkapparat. Vielleicht konnte sie davon noch partizipieren. Doch der Kriminaltechniker entließ Marie mit einem nüchternen „Jow, geht voran. Ich denk dran lang.“
Marie war nur ein wenig enttäuscht, denn bei Otto wusste man ja nie um seine Langzeitwirkung. Man wusste nie, was der zurückgezogen hier in seinen heiligen Hallen nun über diesen neuen Fakten ausbrütete. Marie wusste nur, sie würde davon dann als Erste erfahren.
Der Weg heraus aus der KTU führte Marie an dem Kühlraum vorbei, in dem in einer Lade auch der kleine Albino-Junge lag. Vor ihrem inneren Auge tauchte wieder das Bild des pozellanfarbenen Babyleichnams auf, der seine beiden Händchen im wahrsten Sinne des Wortes beschwörend in den Himmel streckte. Die drei verbliebenen Fingerchen – Daumen, Zeige- und Mittelfinger – waren ja die drei Schwurfinger. Marie formulierte einen sehr klaren Gedanken in ihren Kopf: Ich schwöre dir, Kleiner, ich finde heraus, was passiert ist mit dir, und ich finde den- oder diejenige, die dir das angetan hat.
Als Untermalung ihrer Gedanken kamen nun wieder die eindringlichen Trommelrhythmen hinzu. Marie blieb vor der ersten Stufe des nüchternen Behördentreppengangs stehen und schloss ihre Augen. Die Trommeln brandeten in ihrem Schädel ekstatisch auf, ein gewaltiger von innen dröhnender Kopfdruck. Sie sah vor ihren geschlossenen Augenlidern eine massige Person, die sich über etwas beugte und daran hantierte.
Das war wohl Kojo, die Statur könnte passen.
Die Gedanken, das Einschalten ihres Verstandes, ließen sofort die Trommeln vestummen und lösten die Bilder in schwarze Schlieren auf.
Mit einer Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung über die Auflösung dieser Vision stieg Marie die Treppen hinauf und verließ das Dienstgebäude. Sie hatte ihr Portemonnaie mitgenommen und holte sich nun erst einmal beim Chinamann ihr Mittagessen. Ihr Magen knurrte herzzerreißend, als sie im chinesischen Imbiss auf die frische Zubereitung ihres scharfen Gemüsegerichts – Tofu war hier leider nicht zu bekommen – wartete und den jungen feingliedrigen Koch fasziniert bei der hingebungsvollen Mischung und Verarbeitung der Zutaten im Wok beobachtete. Die chinesische Bedienung – eine ebenfalls sehr zarte junge Frau – lachte sie daraufhin freundlich an und nickte wortlos, aber vehement gestikuliernd in Richtung auf ihren Bauch.
„Ja, ich habe mächtig Hunger, und es ist schön, dass ich bei Ihnen nun etwas dagegen bekommen kann,“ meinte Marie auf die Geste ihres Gegenübers zu antworten.
Sie ließ sich ihr Essen einpacken, bezahlte mit kleinem Trinkgeld und trollte sich zurück an ihren Schreibtisch.
Der Nachmittag verlief ruhig. Marie erledigte ihre Aktenarbeit. Das heißt, sie belegte alle ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse in dem Fall. Sonst ein notwendiges Übel, fühlte sich Marie so zufrieden und rund, dass ihr die Niederschriften sehr leicht von der Hand gingen.
Marie hörte den Nachmittag über weder etwas aus Tansania noch von Gabi Schlieper. Sie wusste aber, dass die Angelegenheiten in Arbeit waren. Sie war aus ihrer Mitte heraus gelassen und zuversichtlich, dass sich der Fall in den nächsten Tag lösen würde. Ihr kam sogar dazu das Wort „auflösen“ in den Sinn – was immer das zu bedeuten hatte.
Sie rief „ihren“ Gerichtsmediziner Dr. Wilfried Möller in Kiel an und berichtete ihm von ihren neuesten Erkenntnissen. Der Pathologe bedankte sich für die Informationen, ging aber inhaltlich nicht weiter auf sie ein. Er machte den Eindruck, als wäre er intensiv mit etwas anderem beschäftigt, aber zu höflich und auch gleichzeitig zu neugierig, um Marie abzuwimmeln. Marie wusste, der Doc würde die Fakten abspeichern und beizeiten könnte ihm dazu etwas einfallen. Sein Gehirn tickte ohnehin manchmal etwas anders. Aber es tickte hervorragend.
Mochita hatte über einen Samuel Kojo nur wenig Weiterreichendes herausbekommen können. Interpol hatte nichts über einen Mann dieses Namens und auch ihre eigene Recherche war kaum ergiebiger als die von Marie gewesen. Sie hatte lediglich etwas über einen Samuel Kojo auf Französisch gefunden. Mochita beherrschte Französisch recht gut und konnte Marie das Wesentliche übersetzen. Dieser Samuel Kojo war der Leiter eines afrikanischen Kinderhilfsdienstes.
Allerdings hatte Mochita noch etwas über Ismael Murundi herausgefunden. Es gab ein Gruppenfoto von tansanischen Afrikanern im Internet, auf dem der ältere der Murundi-Brüder sowie sein damals bester Freund Sokwe Soselo zusammen abgelichtet waren. Alle Portraitierten waren namentlich aufgeführt, deshalb konnte Google das Foto überhaupt bei der Suchanfrage „+Murundi +Soselo“ finden. Es handelte sich um das offzielle Foto eines Fußballpiels: der lokale Fußballclub Mwanza in einem Freundschaftsspiel gegen die Mannschaft der International Highschool in Kapstadt.
Marie schaute sich Ismael Murundi genauer an. Soweit es die Bildqualität zuließ, erkannte Marie einen sehr gut aussehenden jungen Mann. Zum Zeitpunkt des Spiels mussten die beiden Freunde etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Beim zweiten Hinsehen fiel Marie auf, dass Ismael der bei weitem Hellhäutigste unter all den 22 Spielern war. Nicht weißhäutig, aber deutlich heller im Teint als die übrigen Fußballspieler. Womöglich war das Haar an der Babyleiche von ihm, dem leiblichen Onkel. Sie würde noch herausfinden, welche Rolle der Onkel in der ganzen Angelegenheit spielte, ob er der gute oder der böse Onkel war.
Doch jetzt war erst einmal Schluss für heute. Sie wollte sich heute einen langen Nachmittag zuhause gönnen, vielleicht mit oder auch ohne Lukas, Klara oder sogar Fritz. Ob Martin von seinem Dreh heute in Hamburg hochkommen konnte und wenn, wann, das stand in den Sternen. Vielleicht würden es auch ruhige Stunden allein werden. Da hätte sie auch nichts gegen. Sie hatte einiges zu verdauen und würde, wenn es ihr Familienleben zuließ, nicht nur eine Turbomeditation, sondern auch gerne einmal wieder eine richtig lange Medition machen. Sie würde sehen.
Auf der Heimfahrt gönnte ihr der Radiosender die Originalfassung der wunderbaren Rumba von Nancy Sinatra mit ihrem Vater, wenngleich sie die Neuauflage von Robbie Williams und Nicole Kidman gar nicht so schlecht fand. Den Titel konnte sich Marie nicht merken, aber dieses Lied war ein wundervolles Liebeslied: „…saying something stupid like I love you…“. Und ihr war genau so zumute. Laut und voller Inbrunst sang sie im Auto mit, wie sie es so gerne tat, wenn sie alleine fuhr. Der abgeschottete Innenraum des Wagens konnte Marie eine so entspannte Intimität verschaffen, wie sie sie sonst kaum in der Badewanne bei verschlossener Tür erlebte.
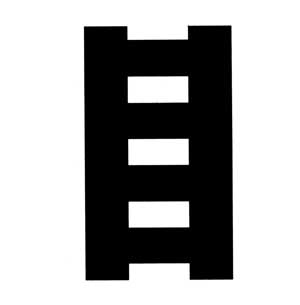
29
Zuhause war tatsächlich niemand. Zwei Zettel lagen auf dem Küchentisch: Bin bei Tom, Boot bauen, natürlich von Lukas. Tom war Lukas bester Freund. Und Marie erinnerte sich, dass die beiden Jungs zusammen ein Boot bauen wollten, eines, das sie richtig zu Wasser lassen konnten. Da würde Lukas sicherlich erst später, nach dem Abendbrot, gegen sieben oder acht Uhr von den Komnicks zurückkommen. Sabine und Ludger Komnick waren nette Leute, wohnten mit ihrem Sohn zwei Höfe weiter. Ludger machte für SAP in EDV und Sabine war eine ausgezeichnete und inzwischen auch recht erfolgreiche Goldschmiedin. Sie hatten die Absprache, dass ihre Kinder sich natürlich ohne weiteres besuchen konnten und auch zum Essen bleiben konnten. Sie sollten nur Bescheid sagen, dass sie jeweils drüben waren.
Bin bei Fritz. Ich komme erst morgen Mittag wieder. Koche dann. Klara. Der zweite Zettel erfreute Maries Herz mit dem warmen Gefühl der Mitfreude. Sie freute sich so sehr für das Glück ihrer Mutter und auch sehr darüber, dass Klara ihre Familie nun daran Anteil haben ließ.
So hatte Marie nun tatsächlich ihre sturmfreie Bude. Sie duschte sich kurz ihr Büro und ihre Gedanken zum Fall von ihrem Körper und setzte sich anschließend unter ihren Lieblingsbaum im Garten, eine steinalte Eiche. Hierhin hatte Marie vor einiger Zeit einen Findling geschafft, vielmehr sie und zwei Männer aus der Nachbarschaft, weil sie alleine den großen Stein keinen einzigen Millimeter bewegen konnte. Der Findling war auch in Wirklichkeit kein Findling, sondern ein echter Ostseebrocken. Doch da man von der Ostseeküste keine Steine mitnehmen darf, hatte Marie die offizielle Version des Findlings gewählt. Den Stein umschwang nun die Aura des eiszeitlichen Gletscherabriebs. Nur Marie wusste, dass die See an ihren Liebling mit ihrer langsamen Kraft Hand angelegt hatte.
Soweit es das norddeutsche Wetter zuließ, war dies hier ihr Lieblingsplatz für ihre Mediation. Das klappte aber meist nur, wenn niemand sonst im Haus war, denn sonst wurde sie an dieser Stelle meist angesprochen, oder nur angesehen, oder Marie meinte, dass sie von irgendwem beobachtet würde oder sie gleich jemand anreden würde. Selbst wenn sich ihre Leute im Haus aufhielten, konnte sie sich hier nicht wirklich konzentrieren. Aber heute schon. Alleinsein konnte ein genauso großes Geschenk sein wie eine wunderbare Familie.
Sie setzte sich auf den oben zu einer angenehmen Sitzfläche abgeflachten Stein und goss sich zunächst ein großes Glas ihres köstlichen Brunnenwassers ein. Sie leerte es in einem Zug. Dann stellte sie ein weiteres gefülltes Wasserglas vor sich und begab sich mit einem Mantra in ihre Meditation.
Marie fühlte sich heute einigermaßen in ihrer Mitte und hatte sich für eine sehr ruhige und mental sehr anspruchsvolle Meditation entschieden. Nachdem sie sich mit ihren Mantren eingestimmt hatte, stellte sie sich eine weiße Wand vor – und versuchte sie, über die Zeit zu halten. Nichts weiter als eine weiße Wand.
Sie sah Lukas und Tom mit begeisterten Gesichtern über ihren Bootsplänen brüten, während ihr Held Martin gerade auf die durchtriebendste Weise ein junges, wenn nicht gar minderjähriges Mädchen verführte. Martin sprach mit gekünstelter Stimme, etwa so wie in den ersten Tonfilmen, die noch von den Stummfilmakteuren dargestellt worden waren. Die ersten Tonfilme waren dementsprechend überkandidelt. Die Schauspieler füllten ihre Rollen mit ihrer zunächst noch unbemerkt, durch den Ton aber überholten dramatischen Gestik und Mimik. Hinzu kamen ihre überdrehten Lautäußerungen, die nun erstmals im Kino zu hören waren. Von allem zu viel. Marie ließ die Gedanken an ihre beiden geliebten Männer los und konzentrierte sich wieder mit ihrer Willenskraft auf die weiße Wand.
Fakten zum Albino-Fall kreuzten durch ihren Kopf – schwarze Geländewagen, die Holzpuppe, mit Goldfäden gewirkte Fischernetze, die in den Viktoriasee ausgeworfen wurden, das Weiß im Augapfel dunkler Augen, angestrahlt von einem flackernden Feuer, fünf weiße Ringe auf schwarzem Untergrund, ein weißes Kind, dass unter vielen Schwarzen spielt, eine bullige schwarze Gestalt und grüne Bananen – und wieder tauchten Bilder des toten Babys vor ihrem inneren Auge auf. Marie beharrte jedoch auf der weißen Wand in ihrem Kopf. Sie setzte sich noch etwas aufrechter hin, schob ihr Brustbein leicht nach vorn und spannte ihren Beckenboden etwas an.
Vier aufwändig verzierte Kästchen aus edelstem Holz tauchten nun vor der weißen Wand auf. Marie schickte auch sie mental weg. Ihr drittes Auge begann zu schmerzen. Es fühlte sich an, als drückte ein überdimensionaler Daumen zwischen ihre Augenbrauen. Der Druck wurde immer stärker. Und die vier Holzkästchen ließen sich auch nicht wegschicken. Sie schwebten immer wieder vor die weiße Wand. Marie summte der Kopf. Ein Gefühl, wie kurz vor dem schwindelig sein.
Marie gab nach. Denn die Holzkästchen wollten ohnehin nicht verschwinden. Sie ließ sich also auf sie ein. Marie konzentrierte sich jetzt auf die dunkelbraunen Holzschachteln und ging mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit in den Bilderstrom in ihrem Kopf. Daraufhin öffneten sich die Holzkästchen und gaben Marie ihren grausigen Inhalt frei. In jedem Kistchen steckte sorgfältig aufpräpariert ein winziger weißer Finger. Marie wusste natürlich sofort, was sie da vor sich hatte. Sie hatte genau das gleiche schon in Rendsburg gesehen. Ein Kästchen nach dem anderen wurde geöffnet und gestattete Marie einen Blick in seinen grausigen Inhalt.
Doch Marie war nur die Beobachterin. Es gab noch jemand anderen in den Bildern, der ebenfalls auf diese winzigen Baby-Finger starrte. Sehr viel näher. Diese Person hatte auch die Kästchen geöffnet. Da durchbrach ein markdurchdringender Schrei die bedrückende Stille. Irgendwas oder irgendwer stürzte sich auf die beiden starrenden Augen und ein furchtbarer Zweikampf entbrannte. Die beiden Gestalten schlugen und hieben und prügelten hemmungslos aufeinander ein. Die Möbel in dem Raum fielen um, wurden geworfen und zerbarsten. Bis die kräftigere Gestalt ein Messer zog, das mit kaltem Silberlicht in Maries Kopf aufblitzte.
Marie musste alle ihre Willensstärke und Konzentration zusammennehmen, um nicht aus diesen Bildern herauskatapultiert zu werden. Doch sie war entschlossen, sich jetzt diesem Einblick zu stellen.
Das Messer unterbrach augenblicklich die Schlägerei. Dafür tauchte ein langer Stock mit einem zerzauselten Stück Stoff am Ende auf und wirbelte immer wieder in Richtung auf das blinkende Messer. Die Gestalt mit dem Stock schrie fürchterlich in einer Marie fremden Sprache. Sie war wie von Sinnen und schlug mit aller Kraft um sich. Das Messer leuchtete inzwischen nicht mehr auf, es war rot von Blut. Wie ein Wahnsinniger schrie die schmalere Gestalt und rannte, den Stock wie eine Art mittelalterliche Lanze voraus, auf das Messer und dessen Träger zu. Es gab ein furchtbares Poltern, so als ob weitere Tische und Stühle zu Bruch gingen. Dann war es von einem auf den nächsten Augenblick muchsmäuschenstill. Kurz wurde die Stille von einem Geräusch wie von einer platzenden Wasserblase unterbrochen. Es folgte ein kurzes Gluckern. Dann war es totenstill. Die schlankere Gestalt griff eines der Holzkästchen und lief und lief, ehe das ganze Szenario in gleißendes Licht getaucht wurde und Marie mit einem gewaltigen Kopfdruck wie aus einem Tiefschlaf erwachte.
Als sie langsam ihre Augen öffnete, blinzelten sie in einen überdimensionalen orangenen Ball. Die Sonne wechselte gerade ihre Erscheinung zur Abendsonne. Der rötliche Abendbelag begann sich gerade besänftigend über das helle Gelb zu legen, das noch am Himmel gestanden hatte, als Marie ihre Augen schloss.
Das grelle Licht war Gott sei dank nur in ihrem Inneren erschienen. Na ja, weiß heißt „nur“. Maries Gedanken kamen nur langsam wieder in Fahrt. Was sie gerade gesehen, geradezu vorgeführt bekommen hatte, konnte sie wahrhaftig nicht als „nur“ bezeichnen. Da hatte etwas auf Leben und Tod stattgefunden. Und beide geistigen Disziplinen hatten ihren Teil davongetragen. Jeder der beiden Aspekte hatte einen Menschen gewonnen und davongetragen.
Das war kein gespielter Kampf gewesen, wie Marie ihn aus dem Fernsehen kannte, oder einfach ein Traum – Marie wusste, dass das Blut, das an dem Messer klebte, echt war. Es war warm. Trotz der Kälte der Person, von der es stammte.
Sie leerte das vor ihr stehende Wasserglas in einem Zug, goss sich den Rest aus der Flasche nach und trank auch dieses Wasser in großen Schlucken.
Das Wasser nahm ein wenig den Druck aus ihrem Kopf. Er fühlte sich an, als hätte sie soeben versucht einen Rausch auszuschlafen – wie bei ihrer letzten Vision. Doch trotz der gewaltsamen Bilder, trotz des vielen Blutes war Marie in keinster Weise aufgeregt oder gar innerlich verschreckt. Sie fühlte sich trotz dieser blutrünstigen Sequenz in – oder vor? – ihrem Kopf ruhig und spürte ihre Kraft sehr zentriert in ihrem Solarplexus.
Hatte sie soeben einen Mord oder eine Art tödlichen Unfall gesehen? Von der Statur her, obwohl sie die Gestalt in den dunklen Bildern kaum hatte auflösen können, hätte es Samuel Kojo sein können. Kojo mit den schrecklichen Zauberkistchen aus Edelholz, genau so, wie sie eins in den Eiderwiesen gefunden hatten. Aber die schlankere Person konnte sie beim besten Willen niemandem zuordnen. Es hätte von der Gestalt her Sokwe Soselo sein können, auch wenn ihr das eher unwahrscheinlich vorkam, vielleicht aber auch einer der Murundi-Brüder oder noch eine ganz andere Person. Sie konnte nicht einmal sagen, ob die Person schwarz- oder hellhäutig war.
Marie merkte, dass sie schon wieder voll in ihrer Kopfarbeit war. Dabei hatte sie den ja gerade ausschalten und zur Ruhe kommen lassen wollen. Deshalb war sie ja in die Meditation gegangen. Sie spürte noch einmal in sich hinein: Tatsächlich fühlte sie sich ruhig und zentriert.
Mit einem Mal spürte sie eine warme feuchte Zunge, die ihre langgezogenen Bahnen liebevoll über ihren nackten Unterarm zog. Sie hatte ihre Arme zur Seite abgewinkelt und hielt sich mit ihren Händen an ihrem Felsbrocken fest. Sie spürte, wie fest sie ihre kräftigen Hände an den Stein presste, so als wollte sie ihn, und mit ihm die Erde, unter keinen Umständen loslassen. Schwerer Atem und eine feuchte Nase stupsten sie nun sanft in den Nacken. Willi. Wie wohltuend. Ein lebendiges Wesen aus Fleisch und Blut. Und voll Zuneigung und Liebe. Prompt ging sein nasser Waschlappen quer durch ihr Gesicht. Nun war Marie wieder ganz und gar auf dieser Welt, im Garten, auf dem Stein, unter der Eiche, auf ihrem Hof, in Sande am Wittensee.
Willi hatte wohl unter seinem Rhododendron gelegen. Sein Lieblingsplatz, den er sich zu einem gemütlichen Plätzchen mit Mulde ausgebuddelt hatte. Der Hovawart begann schlecht zu hören, wenn er inzwischen nicht eh schon ein wenig taub war. Der Hund hatte sie wohl gar nicht kommen hören, war vielleicht selbst weit weg auf einer seiner Seelenreisen gewesen. Nun war er aufgewacht und hatte seine Menschin bemerkt.
Marie kraulte den alten Burschen dankbar hinter den Ohren, was der Rüde mit einem wohlwollenden Brummen quittierte. Der große Hund warf sich auf den Rücken und ließ sich von Marie genüsslich Bauch und Brust massieren. Marie ging in kleine Kreisbewegungen über: einmal herum und dann noch Mal einen Dreiviertelkreis. Und das gleiche mit sanftem Druck erneut an einer benachbarten Stelle von Willis Bauch. Willi liebte Tellingten Touch. Das tat seinen alten Knochen gut. Und er streckte Marie dazu auch noch gerne sein Hinterteil entgegen. Als die Hinterbeine dran waren, machte sich der große Pelzkerl lang und länger und streckte sich voller Wohlbehagen auf seine längste Länge.
Nach einigen Minuten merkte Marie, dass sie aufstehen musste, dass sie sich bewegen musste. Sie streckte sich und dehnte vor allem ihre verspannte Nackenmuskulatur. Willi hatte sich ebenfall erhoben und schüttelte sich. Um diese Bewegung beneidete Marie manchmal die Hunde. Das sah für sie immer so aus, als schüttelten die Hunde damit alles ab, was nicht auf oder an sie gehörte. Marie versuchte die sparsamere menschliche Variante, um ihre Glieder zu lockern und die Bilder von eben erst einmal auf Distanz zu halten.
Dann startete sie mit einem schwanzwedelnden Willi eine kleine Spaziergangrunde zum See. Am Strand warf sie Stöckchen und ließ sich von dem wohlwollend apportierenden Hund in der Gegenwart halten.
Wieder Zuhause stellte Marie Willi sein Fressen runter und schmierte sich selbst eine schnelle Stulle im Stehen. Kurz darauf kam auch schon Lukas nach Hause. Der Achtjährige war ganz erfüllt von seinem Schiffsbau. Ihr Sohn erzählte allerdings überglücklich alles durcheinander, weil er gleichzeitig völlig müde war und im Stehen hätte einschlafen können. Marie verstand nur Segel und Fock und lackieren und bugsierte ihren Sohn mit traumwandlerisch geübten Griffen und Worten über das Badezimmer, wo tatsächlich noch einige katzenwäscherische Zahnbürstenstriche stattfanden, ins Bett. Lukas fielen sofort die Augen zu und sein gleichmäßiger Atem gab seine Seele dem Frieden der Nacht preis.
Marie goss gerade kochendes Wasser auf ihren Maisbarttee, als das Telefon klingelte.
„Liebes, hier ist dein Nicht-James-Bond, 0011!“
„Aaah,“ seufzte Marie in den Hörer. „Schön, dass du noch anrufst, dass ich wenigstens deine Stimme noch hören kann.“
„Ich drücke dich durch den Hörer, Marie. Ich wäre gerne jetzt bei dir draußen, würde gerne mit dir unter deiner Eiche liegen. Es war so heiß heute in der Stadt. Und kein Lüftchen ging.“
„Und ich hatte heute so einen Bürotag, dass ich von der Hitze kaum was mitbekommen habe. Ich bin zwar schon früh raus und nach Hause, aber da ging es schon wieder. Hier weht es ja immer ein wenig.“
Pause.
„Und ich vermiss dich. Ich würde so gerne heute neben dir einschlafen.“
Von der Vision wollte Marie Martin nichts erzählen, das war für sie kein Gesprächsstoff fürs Telefon. Wenn überhaupt.
„Weißt du schon, wann du wieder hier bist?“
„Wir haben jetzt noch drei Hauptdrehtage. Da werde ich nicht wegkönnen. Ehe ich als Bösewicht den Serientod erleide, muss ich hier ziehmlich präsent sein. Also, ich denke, vor Samstag wird das nichts. Aber ich denke ganz viel an dich, Marie. Ich will dich und nur dich. Wenn ich hier reihenweise die jungen Mädels küssen muss…“
Marie räusperte sich mit gespielter Strenge.
„…dann taucht fast immer dein Gesicht vor meinem inneren Auge auf.“
„Aha, also bei Blondinen dann doch nicht? Die küsst mein Rotfuchs dann in echt!“ ging Marie auf die Vorlage ein.
„Ja, ja. Echt muss das schon sein. Ich bin ja schließlich ein guter Böser.“
„Ja-ja, während ich hier vertrockne,“ spielte Marie weiter, „küsst sich mein Liebster durch die Hamburger Blondinen. wie war das noch: Wirst du dafür nicht auch noch bezahlt, mein großer Gigolo?“
„Pass bloß auf!“ Martin säuselte mit gespielter Schärfe zurück. „Wenn ich jetzt bei dir wäre…“
„…dann würde ich dich jetzt mit einer wasserstoffblonden Langhaarperücke ins Bett lotsen.“
„Ich liebe dich, Marie!“
„Ich liebe dich auch, Martin.“
„Bis morgen, Liebes.“
„Ja, mein Hüne. Und schlaf gut. Bis dann.“
„Du auch…“
Mit leichtem Zögern legte Marie auf. Es fiel ihr doch ganz schön schwer, Martin nun wieder loszulassen. Doch mit einem Seufzer – der jedoch mehr ihrem beinahe verhängsnivoll geendeten Fehler mit diesem anderen Mann galt, was war sie nur töricht gewesen – konnte sie sich aus ihrer leichten Liebeswehmut loseisen. Schon beim Zähneputzen begann Marie wieder gutgelaunt zu summen. Und kaum dass sie in die Waagerechte gelangt war, klappten ihre Augen auch schon zu, übermannte sie die wohlige Schwärze des Schlafs.
30
Marie wurde nach einer traumlosen Nacht lange vor ihrem Wecker angenehm ausgeruht wach. Sie ging ihre morgentliche Lieblingsrunde mit Willi am See entlang, machte Frühstück für sich und Lukas und weckte dann zärtlich ihren Sohn. Der streckte und reckte sich genüsslich in seinem Bett.
„Hab ich noch fünf Minuten?“ fragte er seine Mutter verschmitzt.
„Ja, ich glaube schon. Ohrkraulen?“
„Ob bitte, Mama. Das hast du schon sooo lange nicht mehr gemacht,“ und der Junge drehte sich, sein linkes Ohr vorstreckend, auf die rechte Seite, so dass Marie gut ran kam.
Ja, bestimmt schon drei Tage nicht mehr, dachte Marie. Ihr Sohn liebte das Hinter-dem-Ohr-Kraulen so lange er auf der Welt war. Schon als er als Neugeborener auf ihrem Bauch lag löst die Berührung der Hinterseite seiner Ohrmuscheln Entspannung und Wohlgefühl aus. Schon das kleine Würmchen streckte sich bei gleichzeitig aufseufzender Beruhigung seines Atems lang und behaglich aus. Über acht Jahre hatte sich diese Wohlfühlstelle nun gehalten. Sie konnte bei Lukas sowohl tröstende Entspannung nach einem wie auch immer gearteten Schmerz als auch schlicht schnurrendes Wohlbehagen auslösen.
Marie kuschelte sich auf Lukas Bettkante, nahm den Kopf ihres Sohnes in den Schoß und knuddelte sanft das Ohr ihres Sohnes. Lukas hatte gar nicht so Unrecht. Wirklich intime Zeit hatten sie beide gar nicht so sehr viel. Sie war arbeitstechnisch viel unterwegs, auch zu eigentlichen Familienzeiten. Es war doch häufig Klara, die Lukas das Frühstück machte, vor allem aber ihn ins Bett brachte. Marie herzte mit diesen Gedanken ihren Jungen, der sich ob der für ihn unerwarteten Umklammerung ein wenig frei strampelte: „Nicht so fest halten, Mama.“
Marie ließ ihre Hände sinken.
„Aber noch ein bißchen kraulen. Die fünf Minuten sind bestimmt noch nicht um.“
Marie grinste: „Du alter Genießer. Du wirst bestimmt einmal ein großer Frauenbetörer…“
„Was hast du gesagt, Mama. Ich habe nichts verstanden. Das ist so laut am Ohr.“
„Ach nichts, Lukas.“
Beim Frühstück erzählte Lukas – diesmal sortiert – von seinem Schiffsbau mit Tom. Sie waren heute nach den Schularbeiten wieder verabredet.
Marie begrüßte diesen initiativen Geist ihres Sohnes sehr und munterte ihn auf: „Wenn ihr was braucht, also wenn euch noch was fehlt, dann ruf mich doch im Büro oder auf dem Handy an. Ich bring euch das dann von unterwegs mit.“
„Ja, Mama, mach ich.“
„So, jetzt müssen wir aber los…“ begann Marie dann doch langsam zu drängeln. Sie selbst hatte Spiel, aber die Schule begann heute pünktlich um Viertel vor Neun.
Kaum im Büro angekommen, reichte eine überaus freundliche und gut gelaunte Mochita Marie mit einem kurzen, aber scharf beobachtenden Blick und „Guten Morgen, Chefin!“ eine Meldung von Interpol rein. Auf dem Zettel stand: Samuel Kojo, ein erfolgreicher Geschäftsmann und Vorsitzender des tansanischen Kinderhilfsdienstes, wurde am letzten Mittwoch in seinem Büro im Regierungsviertel von Daressalam tot aufgefunden. Die Tatwaffe war ein Messer, ein Springmesser mit einer langen Klinge. Ob er das Opfer eines Raubüberfalls geworden ist sowie der genaue Tathergang und weitere Tathintergründe müssen noch geklärt werden. Todesursache ist die beigebrachte schwere Stichverletzung im Bauchraum. Todeszeit vermutlich die frühen Morgenstunden des gleichen Tages. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, zumal es sich wegen des hohen Bekanntheitsgrades von Kojo um eine Angelegenheit öffentlichen Interesses handelt.
Da sitzt euch wohl die Presse im Nacken, ging es Marie durch den Kopf
Marie sprang auf. „Mochita!“ rief sie ihrer Sekretärin hinterher. „Mochita.“
Die kleine Mexikanerin dreht sich um. Marie hatte sie mit einigen Laufschritten rasch erreicht.
„Mochita, fordern Sie bitte so schnell wie möglich das Protokoll von der Tatortbeschreibung an. Wirklich so schnell wie möglich. Es eilt. Ich brauche alle Einzelheiten, und wirklich so detailiert wie möglich. Danke.“
Marie drehte sich auf dem Absatz um und ging forschen Schrittes zurück.
Marie begann, sich nicht mehr zu wundern.
Es war also tatsächlich Samuel Kojo gewesen – gestern – auf ihrem Meditationsstein – in ihrem Kopf – vor ihrem dritten Auge. Der Gönner und Wegbereiter von Sokwe Soselo.
Marie wählte in aufkommender Hektik die Hamburger Telefonnummer. Vielleicht hatte sie Glück.
„Schlieper, Kriminalkommissariat 17, guten Morgen.“
„Moin, Gabi, hier ist Marie. Hast du schon was über diesen Samuel Kojo?“
„Morgen, Marie. Bei dir brennt´s ja. Ich hätte dich auch gleich angerufen. Ich wusste gar nicht, dass du so früh im Büro bist.“
„Doch-doch.“ Marie war zum Bersten gespannt.
„Ja, ich habe was gefunden. Also, deine fremde Sprache bei Google, das ist Swahili, das ist die offizielle Amtssprache in Tansania. Und dein Samuel Kojo ist eine ziehmliche Größe in dem Land. Er hat sein Geld zunächst mit dem internationalen Handel von Viktoriabarsch gemacht. Kennst du doch sicher, der feste wohlschmeckende Fisch, der bei uns vor etwa zehn Jahren aufgetaucht ist und seitdem recht günstig an jedem Fischstand zu haben ist. Den haben wir Kojo zu verdanken. Er hat seinerzeit die internationale Vermarktung begonnen und sehr erfolgreich durchgesetzt. Er stammt übrigens aus einem kleinen Fischerdorf bei Nanso. Das liegt direkt am Viktoriasee, im tansanischen Distrikt Mwanza. Und er bietet dazu noch den Klassiker des erfolgreichen Aufsteigers aus armen Verhältnissen: Aufgewachsen als Sohn armer Fischer hat er sich aus eigener Kraft hochgearbeitet.“
Marie hörte gespannt zu.
„Und seine Herkunft hat ihm wohl immer ein offenes Auge für die teils verheerenden sozialen Missstände in seinem Land bewahrt.“
Nicht nur dafür, auch für die alten, teils barbarischen Traditionen, ging es Marie durch den Kopf.
„Er hat unter anderem den Flying Medical Service von Arusha mit aufgebaut und unterstützt finanziell verschiedene medizinische Hilfsdienste. Tansania ist eines der ärmsten Länder der Erde. Es gibt dort kaum Straßen oder sonstige Infrastruktur, und so ist die Bevölkerung auch bei der medizinischen Versorgung vor allem auf Hilfe aus der Luft angewiesen. Und Kojo hat außerdem einen Kinderhilfsdienst in Tansania ins Leben gerufen. Und er ist wohl derzeit dabei, das Kinderhilfsprogramm über die Landesgrenzen hinweg auszudehnen.“
Wohl kaum, dachte Marie, die den stämmigen Mann im Leichenschauhaus sah.
„Sein Ziel ist es, sich so unabhängig wie möglich von den Weißen und den Industrieländern zu machen und das afrikanische Selbstbewusstsein nach all den Jahren der Kolonialisierung zu stärken.“
„Und dazu ist ihm anscheinend jedes Mittel recht gewesen…“ warf Marie brummend ein.
„Vor Ort ist Kojo scheinbar sehr beliebt, weil er seine Landsleute unterstützt wo er kann,“ fuhr Gabi unbeirrt fort. „Er bezahlt den Kindern das Schulgeld und die Begabten schickt er sogar auf Internationale Highschools. Kojo ist sehr traditionsbewusst und unterstützt vehement die Bewahrung von Swahili als offizieller Amtsprache. Und auf internationalem Parkett hat er sich wohl immer sehr zurückgehalten, deshalb ist da kaum was zu googeln. Aber in seiner Heimat ist er eine allseits bekannte Größe.“
„Danke, Gabi. Du hast mir mal wieder sehr geholfen. Du kannst jetzt für dich alles in die Vergangenheit setzen. Dieser sicherlich nicht allseits beliebte Samuel Kojo ist tot. Er wurde tot in seinem Büro in Daressalam gefunden. Und zwar Ende letzter Woche, ein paar Tage nach dem Fund unseres Albino-Jungen.“
„Aha,“ raunte Gabi, die noch nicht verstanden hatte, was das alles miteinander zu tun haben sollte. „Klärst du mich auf, bitte?“ schob Gabi mit ein wenig Nachdruck hinterher, da Marie sich wohl nicht von selbst erklären wollte.
Und Marie berichtete ihrer Kollegin ausführlich von dem Gespräch mit Sokwe Soselo, in dessen Verlauf dem Wissenschaftler, der es nicht im Entferntesten gewohnt war, Geheimnisse zu bewahren, der Name – Gott sei dank – herausgerutscht war. Damit hatte er – ganz sicher ungewollt – eine norddeutsche Recherchelawine losgetreten, die Erstaunliches zutage gebracht hatte. Marie fasste alle Ermittlungsergebnisse von dem verschwundenen Portraitfoto auf dem Schrank der Soselos bis zu der Todesmeldung durch Interpol zusammen. Marie ließ auch ihre Mediationsvision nicht aus, das musste sie jetzt einfach Mal sich und ihrer Kollegin zumuten – sie waren schließlich befreundet.
Gabi Schlieper kommentierte entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit Marie´s Schilderung ihrer Meditationsvision nicht weiter: „Hattet ihr nicht einen Finger des Kleinen bei euch in Rendsburg in einem Park gefunden, und zwar genau in einem solch einem Holzkistchen?“
„Eben. In genau so einem geschnitzten Holzschächtelchen, Edelholz. Ohne Haut.“
„Ja, stimmt ja,“ Gabis Worte schüttelten sich.
„Kannst du das bitte alles Robert erzählen. Mit besten Grüßen natürlich von mir. Der wollte nämlich selbst einiges über den Kojo herausfinden. Ist er schon da?“
„Nein, Robert kommt heute etwas später. Zahnarzttermin. Muss ja auch mal sein.“
„Sicher.“ Marie ging eine andere Gedankenkette durch den Kopf. „Weißt du, ob Robert schon bei Frau Soselo war?“
„Nein, ich glaube nicht. Hätte er sollen?“
„Nein, eben nicht. Wenn er noch keinen weiteren Kontakt zu den Soselos aufgenommen hätte, wäre das sicherlich hilfreicher für uns.“
„Verdächigst du sie jetzt?“
„Nein-nein. Die beiden haben nichts getan. Aber sie wissen mehr, als sie uns bislang zu erkennen geben. Vor allem Frau Soselo.“
Die Murundi-Brüder sind der letzte Schlüssel, sprach Marie aber nun schon nicht mehr aus. Ihr Gedankenprozessor lief auf Hochtouren.
„Gabi, ich muss jetzt Schluss machen. Sagst Du Robert bitte, er möchte mich anrufen, sobald er zum Dienst kommt?“
„Ja, mach ich. Tschüs dann. Wenn du noch Hil…“
Doch Marie hatte schon mit einem geistesabwesenden „tschüs“ aufgelegt.
Noch mit dem Hörer in der Hand klickte sich Marie erneut das Mannschaftsbild von dem interafrikanischen Fußballspiel hoch. Ismael Murundi – das war der dritte von links in der zweiten Reihe von oben. Tatsächlich, der war von seiner Hautfarbe her wesentlich heller als seine Sportskameraden. Sokwe Soselo stand direkt neben ihm. Die beiden Jungs sahen ausgesprochen gut aus, beide sehr feingliedrig mit schönem ebenmäßigem, aber dennoch männlichem, da leicht kantigem Gesicht. Soselo wirkte neben seinem Freund tiefschwarz. So dunkelhäutig war er ihr bei den Begegnungen gar nicht vorgekommen. Der Murundi war eben doch recht hellhäutig. Und auch seine Augen sahen vergleichsweise hellbraun aus.
Marie klickte sich weiter auf die Informationsseiten von Wikipedia zum Albinismus. Konnte das sein, konnte ein Mensch ein bißchen Albino sein? Marie hatte das zwar alles schon einmal gelesen, konnte sich aber an diese detaillierten Fakten nicht genau erinnern.
Sie las: Menschen mit schwächer ausgeprägtem Albinismus sind an ihrem Äußeren nicht immer eindeutig als solche zu erkennen. Sie sehen zwar heller aus als Familienmitglieder ohne Albinismus, doch meist ist noch eine Restfunktion der Melaninproduktion erhalten, so dass es auch Schwarze mit Albinismus gibt, die eine deutlich braune Haut und hellbraune Augen haben.
Das war´s doch. Ismael Murundi war selbst auch Albino. Er hatte nur – im Gegensatz zu seinem Neffen – das Glück, dass ihm ausreichend Hautpigmente zur Verfügung standen, um nicht zu hell oder gar weiß zu sein und damit als solcher aufzufallen. Er war der Onkel, Ismael Murundi war der Albino-Verwandte. Eine DNA-Analyse würde mit Sicherheit ergeben, dass das fremde Haar an der Kinderleiche von ihm stammte. Darauf würde Marie eine Kiste Hefeweizen verwetten, alkoholfrei natürlich.
Marie lehnte sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück und streckte sich.
Was konnte sie jetzt tun, um ihren Verdacht zu erhärten? So lange sie Imbakwe Murundi und seine Tochter nicht gefunden hätten, würde sie wohl gar nichts beweisen können. Und sie müsste auch Ismael Murundi, den Onkel der Kinder und Bruder Imbakwes, zur Fahndung ausschreiben müssen. Dass er diesen Samuel Kojo angegriffen und dabei mehr oder weniger gewollt getötet hatte, konnte sich Marie noch vorstellen. Aber seinen Neffen, der schon so gequält und verstümmelt war, und wo kein Ende seines Martyriums abzusehen war, seines körperlichen Martyriums schon als Baby. Und wenn er größer geworden wäre, die seelischen Qualen: Dieses Gefühl, immer und überall verfolgt zu sein, weil andere Menschen vollkommen rücksichtslos und ohne jegliches Mitgefühl, aus reiner Habgier, – das musste man sich mal vorstellen – ein Stück seines Körpers haben wollten! Konnte das ein Mensch überhaupt aushalten? Das hieß doch permanente Angst und Misstrauen allen Menschen gegenüber.
Marie liefen eiskalte Schauer über ihren Rücken.
Manchmal fragte sich Marie schon, wie dumm Menschen sein konnten, dumm, oder vielleicht passender: verblendet. Das menschliche Gehirn, der so genannte Verstand, war mit so simplen Tricks oder schlichten Argumenten außer Betrieb zu setzen, das war schon unglaublich. Da konnten auch wir Deutschen uns nur an unsere eigene jüngste Geschichte fassen. Die Menschen konstruieren sich Gedankengebäude, und von einem auf den nächsten Wimpernschlag wird ein anderer Mensch als unwert, als Nicht-mehr-Mensch, seiner Würde und seines Lebens beraubt. Da konnte man schon an das Böse in der Welt glauben.
Wahrscheinlich hatte der Vater seinen Jungen genau deshalb nach Deutschland gebracht, nämlich, um ihn vor diesem barbarischen Aberglauben zu retten. Was war da nur schief gegangen? Sollte Imbakwe Murundi doch selbst seinen Sohn getötet haben? Nein, das schien Marie ausgesprochen unwahrscheinlich. Dann wäre Murundi doch nicht extra nach Deutschland gekommen. Diese Schiffsreise kam Marie doch eher wie eine Flucht vor. Bloß, welche unliebsame Überraschung erwartete die drei dann hier in Hamburg?
Marie hatte so gut wie nichts in der Hand. Alles waren nur Vermutungen, Visionen und Vermutungen. Damit konnte sie nicht das geringste ausrichten. Ohne die Murundi-Brüder hatte sie gar nichts.
In ihrem Gedankenstrom tauchten nun die Soselos auf: Frau und Herr Soselo, Johana und Sokwe. Im Grunde waren sie ihre einzigste Chance. Doch sie hatte nicht die geringste Vorstellung davon, wie sie die beiden knacken sollte. Wahrscheinlich schützten sie beiden Sokwe Soselos alten besten Freund, den älteren der Murundi-Brüder. Und freiwillig würden sie ihn ihr sicherlich nicht ans Messer liefern. Was hieß auch „ans Messer liefern“?
Sie sah zwei Möglichkeiten vor ihrem inneren Auge auftauchen: die sanfte oder die harte Tour. Entweder besuchte sie noch ein Mal die Soselos in ihrem Zuhause und versuchte die beiden, vielleicht mit platziert eingestreuten Vermutungen und Rückschlüssen ihrerseits, aus der Reserve zu locken oder sie ließ sie offiziell von Gabi zur Vernehmung auf´s Präsidium vorladen und konfrontierte die beiden in diesem ernüchternden Ambiente mit ihren in diesem Fall zu knallharten Fakten aufgetürmten Überlegungen.
Marie brühte sich einen Darjeeling auf. Die herbe, milde Hitze des Tees tat ihr gut. Sie würde die softere Variante probieren. Irgendwie entsprach ihr das mehr. Das könnte sie auch noch gleich heute erledigen. Nachmittags könnte sie nach Hamburg fahren und die Soselos am späten Nachmittag aufsuchen. Ihr Gefühl sagte ihr, dass sie sich dieses Mal anmelden sollte, um ihrem Auftritt einen offiziellen Rahmen zu geben. Marie suchte sogleich die Nummer der Soselos heraus. Sie hatte auch sofort Frau Soselo am Apparat.
„Guten Tag, Frau Soselo. Hier ist Marie Johannsson, Kriminalkommissariat Rendsburg. Ich müsste dringend noch ein Mal mit Ihnen sprechen. Könnte ich heute nachmittag zu einer Befragung zu Ihnen kommen?“
„Guten Tag, Frau Johannsson,“ antwortete Frau Soselo nüchtern und fuhr nach kurzem Innehalten fort: „Das ist sehr kurzfristig.“
Marie registierte, dass Frau Soselo trotz ihrer Zurückhaltung im Tonfall freundlich war.
Marie legte nach. „Ja, ich weiß. Ich falle etwas mit der Tür ins Haus. Aber es sind neue Fakten in dem Fall um den toten Albino-Jungen aufgetaucht, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte.“
„Wieso gerade mit uns?“ fragte Frau Soselo.
Ihre Tonlage blieb zu Maries Erstaunen freundlich. Marie antwortete nicht. Das Schweigen zwischen den beiden Frauen arbeitete zugunsten Maries.
„Na, dann kommen Sie in Gottes Namen. Aber nicht vor sechzehn Uhr. Ich habe noch einiges zu erledigen.“
„Ich auch, Frau Soselo, das passt gut. Ich würde gerne gegen Viertel nach fünf oder halb sechs kommen. Ist das möglich?“
Marie hoffte, dass zu diesem etwas späteren Zeitpunkt ihr Mann zugegen sein würde oder zumindest im Verlaufe des Gesprächs mit Frau Soselo dazukommen würde.
„Na ja, ich werde das dann ja wohl irgendwie einrichten müssen.“ Dennoch blieb der Tonfall Frau Soselos freundlich.
„Ich danke Ihnen, Frau Soselo.“ Marie reagierte betont höflich. „Dann bis heute nachmittag. Auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen.“
Marie überlegte kurz, ob sie Robert und Gabi verständigen oder sogar hinzuziehen sollte. Sie nahm jedoch Abstand davon, weniger aus einer rationalen Überlegung denn aus einem Bauchgefühl heraus. Allein würde sie am besten mit ihren Vermutungen, Schlüssen und den vorhanden Fakten jonglieren können. Und wenn sie gleich losfahren würde, könnte sie noch lecker in dem kleinen arabischen Imbiss die beste Falafel des Nordens essen.
Marie ging schnell zu Mochita, um ihr über ihre nachmittäglichen Pläne Bescheid zu sagen.
„Sie kommen gerade recht, Chefin,“ begrüßte sie die Mexikanerin freundlich. Die Post ist gerade gekommen und es ist ein dickerer Umschlag aus unserer Zentrale dabei. Express. Ist bestimmt sogar per Bote gekommen. Fühlt sich an wie Fotos. Ich hatte die zuständigen Behörden in Daressalam um Eilzustellung der Tatortfotos gebeten. Ich meine die um den erstochenen Samuel Kojo. Haben sie wohl gleich an unsere Zentrale gemailt. Und die sogar gleich ausgedruckt und weitergeleitet. Manchmal funktioniert das alles ja auch.“
„Ja-ja, Mochita,“ entgegnete eine aufgeregt und unruhig werdende Marie. „Da bin ich ja mal gespannt.“
Mochita schlitzte den DinA 5 Umschlag mit ihrem eleganten, mit mexikanischen Halbedelsteinen besetzten Brieföffnerdolch auf. Es kamen fünf Fotoausdrucke zum Vorschein, begleitet von einer kurzen Notiz.
Marie beugte sich über Mochita und schob das kleine Papierhäufchen ungeduldig auseinander. Mochita half ihr und platzierte die fünf Ausdrucke in zwei Reihen übereinander. Auf einem Bild war die Leiche des sehr stämmigen Samuel Kojo in einer riesigen Lache aus seinem eigene Blut zu sehen. Ein langes schmales Messer lag neben seiner ausgestreckten linken Hand. Zwei weitere zeigten den Toten jeweils aus einer anderen Perpektive. Was Marie interessierte, war die Überblicksaufnahme vom Tatort. Und tatsächlich, hier fand sie, was sie suchte: ein Holzkästchen. Und es sah genau so aus, wie das, was das Liebespärchen an der Eider gefunden hatte und auch genau so, wie sie es klar und deutlich in ihrer Vision gesehen hatte: dunkles, edles Holz, verziert mit einigen auf sie schlicht und abstrakt wirkenden Schnitzereien. Das Kästchen lag geöffnet auf den Boden, etwa anderthalb Meter vom dem Toten entfernt, rechts von ihm. Es lag umkehrt, also mit der Innenseite nach unten auf dem Boden, so dass Marie die außen angebrachten Verzierungen überhaupt auf dem Foto erkennen konnte. Es sah haargenauso aus, wie das, was sie „von oben gezeigt“ bekommen und wie das, was sie in Rendsburg gefunden hatten. Ob sich der grausige Inhalt noch darin befand, konnte man auf dem Bild nicht erkennen.
Kojos Büroraum befand sich in einem chaotischen Zustand, typisch für einen solchen Kampf auf Leben und Tod, der darin stattgefunden hatte. Marie fiel es gar nicht so leicht, ihre Vision, die sie erstaunlicherweise wie einen inneren Spielfilm – fast wie auf DVD – abrufen konnte, von den nun auftauchenden Fakten zu trennen. Sie hätte sich sehr stark konzentrieren müssen, um aus diesem Zustand herauszukommen. Doch sie wollte nun diese Informationsebene nutzen, um in dieser Art Zwischenzustand die vor ihre liegenden Fakten mit den geistigen Informationen zusammenzubringen.
Maries Blick suchte das Foto Quadratzentimeter für Quadratzentimeter ab. Das Durcheinander in dem Raum bestand aus umgefallenen Stühlen und Tischen, Flaschen und Scherben, sowie Unmengen von Akten und Papieren auf dem Boden. Zwischen zwei Beinen eines auf der Seite liegenden Stuhls wurden Maries Augen fündig: ein weiteres dunkles, dieses Mal verschlossenes Holzkästchen stand hier. Marie legte sich das zweite Übersichtsfoto, das aus einer anderen Perspektive heraus aufgenommen worden war, neben das erste.
„Mochita, suchen Sie doch bitte mal mit. Da müsste noch ein drittes Holzkistchen sein, genau wie diese beiden,“ Marie zeigte mit dem Finger auf die beiden, die sie auf den Fotos bereits gefunden hatte.
Mochita schaute etwas verblüfft an ihrer immer noch über sie gebeugten Chefin hoch. Aber sie verkniff sich ihre Frage, woher sie das denn wisse. Mochita spürte, dass hier mehr im Spiel war als die nüchterne Bestandsaufnahme des Tatortes oder Tatherganges.
Nun suchten zwei Augenpaare systematisch die beiden Fotos ab. Nach einigen Minuten zeigte Mochita auf etwas Kantiges, das unter einem umgestürzten Tisch lag.
„Mmmhh,“ Marie musterte skeptisch das kaum erkennbare Detail auf dem Foto. „Könnte sein…“
Die vier Augen scannten weiter die Papierbilder ab.
„Oder das hier?“ versuchte es Mochita erneut, um ihren Einfall sofort selbst zu revidieren. „Nein, das hier ist doch eindeutig zu rund für eine kleine Holzkiste. Aber da hinten, schaun sie Mal, Chefin, hier, das könnte doch auch so eine Kiste sein, hier hinten vor dem Regal.“
Marie kniff die Augen etwas zusammen, um die dunklen Schemen am rechten Rend des Fotos aufzulösen. Sie nahm das Foto auf und hielt es direkt unter die Schreibtischlampe.
„Ja, das könnte es sein. Doch, wenn ich mich sehr konzentriere, dann kann ich auch einen Anflug der Schnitzereien erkennen. Ich denke, das ist das Dritte!“
Marie legte das Foto wieder zu den anderen auf Mochitas Schreibtisch.
Mochita fragte vorsichtig nach: „Was ist denn mit den drei Kästchen?“
„Das ist ziehmlich unappetitlich, Mochita. Wollen Sie das wirklich wissen?“
„Chefin!“ entrüstete sich Marie Sekretärin. „Wir wissen doch beide, dass wir hier nicht in einer Parfümerie oder in einem Reisebüro arbeiten.“
„Na gut! Darin befanden sich die drei Finger unseres kleinen toten Jungen. Albinos gelten in Afrika als Glücksbringer, vor allem ihr Körper, ihre helle Haut.“
„Nein!“ Mochita musste schlucken.
„Damit wird ein grausiger, aber für manchen wohl äußerst lukrativer Handel betrieben.“
Mit leiser Stimme fragte Mochita weiter nach: „Und woher wissen Sie, dass hier die Finger unseres Kleinen drin waren?“
„Wir haben ja ein solches Kistchen an der Eider hier in Rendsburg gefunden. Ein Liebepaar ist drauf gestoßen. Und ich habe es auch gesehen,“ antwortete Marie ruhig. Wenn überhaupt, dann konnte sie am ehesten mit Mochita über ihre Vision reden.
„Gesehen? Hatten Sie eine Erscheinung?“
„Gewissermaßen.“ Erscheinung kam Marie zu heilig vor, erinnerte sie zu sehr an Marien– oder sonstige Erscheinungen. „Ich habe meditiert. Und dann kamen die Bilder. Und zwar genau wie auf den Fotos. Der kräftige Mann, der mit einem anderen ringt und dabei in das von ihm selbst gezogene Messer fällt. Ich habe zwar einen Angriff des zweiten Mannes gesehen, doch das Messer ist eher als Folge einer Selbstverteidigung des zweiten Mannes in Kojos Bauch gelandet. Und es ging irgendwie auch um diese Holzkästchen. In jedem war ein Finger, ein weißer Finger, ein winziger weißer Finger…,“ Marie schauderte es bei ihrem Worten, „…gespannt, aufgebahrt, wie sagte man da?“
Für die spirituelle Mexikanerin, zu deren Alltag die geistigen Dimensionen gehörten, bargen Maries Worte ihrer Vision nichts Ungewöhnliches, doch die Bilder der abgeschnittenen Finger machten sie sprachlos.
„Aber das bleibt unter uns, Mochita, ja? Ich bin schließlich Polizeibeamtin und keine Kaffeesatzleserin – jedenfalls für die übrigen Augen und Ohren der Welt.“
„Ja, klar, Chefin. Schon verstanden.“
„Eigentlich wollte ich Ihnen sagen, dass ich gleich wieder nach Hamburg muss. Aber das mit den Fotos kam genau richtig. Das ist eine passende Bestätigung meiner Visionen. Genau richtig. Das macht mich bei dem Gespräch heute nachmittag – ich bin nochmal bei den Soselos – noch wesentlich sicherer.“
„Gut. Dann weiß ich Bescheid. Wissen die Hamburger auch Bescheid, der nette Herr Leicht und die Frau Kommissarin, die Frau Schlieper?“
„Nein, noch nicht. Sollte einer von den beiden anrufen, sagen Sie einfach, dass ich noch mal bei den Soselos bin.“
Und nach einer kurzen Pause: „Und alleine.“